15. Dezember 2007
 Gespräch mit Olaf Harms zu den Bürgerschaftswahlen in Hamburg
Gespräch mit Olaf Harms zu den Bürgerschaftswahlen in Hamburg
Für die Bürgerschaftswahlen am 24. Februar 2008 kandidierst Du auf Platz 10 der Kandidatenliste der LINKEN. Mit Rücksicht auf die Föderation der türkischen Arbeitervereine (DIDF) hattest Du darauf verzichtet, für Platz 6 der Liste zu kandidieren. Warum geschah dies und wie bewertest Du dein eigenes Ergebnis?
Die Hamburger LINKE hatte schon vor Monaten signalisiert, dass sie mit offenen Listen antreten will. Allerdings sah sich der Vorstand nicht dazu in der Lage, einen Personalvorschlag für die Delegierten des Wahlparteitages zu unterbreiten. So gab es viele Bewerber. Wir hatten verdeutlicht, dass wir uns nicht auf Konkurrenzkämpfe mit anderen Gruppen einlassen werden. Die DIDF ist eine große Migrantenorganisation und sie gehört zu unseren Bündnispartnern.
Was mein Ergebnis anbetrifft, so will ich unterstreichen, dass dies das Resultat der Arbeit unserer gesamten Bezirksorganisation ist. Es zeigt, dass unsere Genossen in ihrer Tätigkeit, insbesondere in den Stadtteilen, anerkannt sind. Dass wir nach 1989 an einer eigenständigen Kommunistischen Partei festhielten und dann das Profil kommunistischer Politik in harter Arbeit wieder schärften, das wird heute auch von den LINKEN anerkannt.
Antikommunistische Ressentiments gab es nicht?
Auf dem gesamten Wahlparteitag gab es keine Äußerung, die in diese Richtung wies. Etliche Delegierte setzten sich sogar dafür ein, dass die DKP auf der Kandidatenliste vertreten ist. Diesen Standpunkt hat die Listen-Erste Dora Heyenn auch auf unserer eigenen Bezirkskonferenz unterstrichen. Sie sagte, dass ihr die Zusammenarbeit auch deshalb sehr wichtig sei, weil die DKP als marxistisch-leninistische Partei Aufgaben hätte, die von der LINKEN gar nicht übernommen werden könnten.
Nach Meinungsumfragen liegt die LINKE bei sieben bis acht Prozent. Werden es 8,3 Prozent, steht die Chance nicht schlecht, dass du selbst in die Bürgerschaft einziehst.
Das ist für mich nicht entscheidend. Viel wichtiger ist es, dass überhaupt eine linke Fraktion in das Rathaus einzieht. Bei 5 Prozent wären es sechs Abgeordnete. Darunter ein guter Vertreter der Erwerbsloseninitiativen und Aktive aus Betrieb und Gewerkschaft.
Für die DKP wäre es doch aber von Bedeutung, wenn auch ein Kommunist in die Bürgerschaft zöge. So wie in die Bezirksversammlungen von Wandsbek und Harburg. Denn hier kandidieren DKP-Mitglieder schon ab Platz 3 der jeweiligen Listen.
Ein Kommunist in der Bürgerschaft – das wäre natürlich von Bedeutung. Doch lass uns darüber diskutieren, wenn es der Fall sein sollte. Zu den Bezirken möchte ich ergänzen, dass wir auch in Altona gute Chancen haben, mit einer Genossin in das Bezirksparlament einzuziehen. Für uns ist das eine große Chance. Denn diese Genossen benötigen dann die feste Einbindung und die Unterstützung ihrer Wohngebietsgruppen. So könnten wir unser kommunalpolitisches Profil deutlich schärfen.
Was wäre daran das Spezifische?
Sich, wie es Lenin sagt, um das Teewasser zu bekümmern. Also um die Alltagssorgen der Menschen. Diese müssen wir mit den außerparlamentarischen Bewegungen und den dortigen Kämpfen verbinden. Es reicht nicht aus, wenn die SPD zum Beispiel fordert ein kommunales Stadtwerk zu gründen und das dann als Großkunde bei den Energieversorgungsunternehmen auftritt. Die Energiepreise werden sich nur senken lassen, wenn auch die Versorgungsunternehmen wieder in staatlicher Hand sind. Hier verknüpfen sich die Interessen der Belegschaften mit denen der Konsumenten. Zudem gilt: Nur mit dem Druck der Straße, werden wir in den Parlamenten etwas erreichen.
Wie und mit welchen Schwerpunkten wird die DKP Wahlkampf betreiben?
Wir unterstützen den Wahlkampf der LINKEN. Gleichzeitig entwickeln wir eigene Aktivitäten und geben auch eigene Materialien heraus. Inhaltlich geht es um jene vier Punkte, die auch im Sofortprogramm der LINKEN betont werden: Der Kampf für mehr Demokratie und gegen den Abbau demokratischer Rechte. Zum Beispiel bei den Volksentscheiden. Der Kampf gegen weitere Privatisierungen und für die Rekommunalisierung privatisierter Bereiche. Dann der Bereich Arbeit und Soziales. Wir sagen:Hartz IV muss weg. Kompromisse kann es da nicht geben. Bis dies erreicht ist, fordern wir eine Anhebung des Regelsatzes auf mindestens 500 Euro. Alternativen zu der auf Ausgrenzung und Selektion gerichteten Bildungspolitik des Hamburger CDU-Senats, bilden den vierten Schwerpunkt.
Als DKP werden wir außerdem friedenspolitische und antifaschistische Positionen betonen. Frieden ist nicht alles, aber ohne Frieden ist alles nichts. Hamburg ist eine Rüstungsmetropole. Wir sagen: Rüstung vernichtet Arbeitsplätze, ist eine gigantische Verschwendung öffentlichen Vermögens. Im antifaschistischen Bereich kämpfen wir gegen den Einzug der DVU in das Landesparlament. Deshalb haben wir im Hamburger Bündnis gegen Rechts den Aufruf Keine Stimme den Nazis mit initiiert. Als Erstunterzeichner konnten bekannte Schauspieler, Fußball-Kicker, zahlreiche Wissenschaftler, aber auch etliche Gewerkschafter und Betriebsräte gewonnen werden. So soll ein Klima entstehen, in dem die Nazis keine Chance haben, ihre rassistischen Aktivitäten zu entfalten.
Warum hat es sich die DKP eigentlich so schwer gemacht, die LINKE zu unterstützen? Die Entscheidung fiel ja erst nach Aufstellung der Kandidatenlisten.
Das kann ich so nicht akzeptieren. Denn schon im Dezember 2006 haben wir politische Kriterien erarbeitet. Selbst nicht zu kandidieren und stattdessen die LINKE zu unterstützen, das haben wir davon abhängig gemacht, ob es ihnen gelingt, klare Position gegen die Privatisierungen, für die Zusammenarbeit mit außerparlamentarischen Bewegungen, für eine konsequente Oppositionspolitik zu finden. Wir mussten ja berücksichtigen, dass es eine neue Partei mit zahlreichen neuen Mitgliedern ist. Wir wollten dann schon abwarten, wie sich diese positionieren. Denn eines ist doch auch klar: Wäre es so wie in Berlin, dann hätte es die Unterstützung der DKP nicht gegeben.
Wahlumfragen besagen, dass Bürgermeister Ole von Beust (CDU) nur abgelöst werden kann, wenn nach den Wahlen alle Oppositionsparteien bei der Bürgermeisterwahl zusammen stehen. Wie ist deine Haltung zu diesen Fragen?
Das halte ich für abwegig. Es widerspräche zudem den Beschlüssen der Linkspartei. Selbst wenn eine linke Fraktion das Zünglein an der Waage wäre, so geht es doch auch dann um inhaltliche Fragen. Ich sehe die Aufgabe einer solchen Fraktion eher darin, die Finger in die Wunden der Regierungspolitik zu legen und aus der Opposition heraus Veränderungen zu bewirken.
Die SPD hat aber gerade ein Wahlprogramm beschlossen, wo man meinen kann, es sei bei den LINKEN abgeschrieben.
Links blinken, heißt noch nicht links zu handeln. Wenn SPD-Bürgermeisterkandidat Michael Naumann nun bestimmte Positionen übernimmt, dann ist das ein erster Erfolg. Doch bisher ist es nur Wahlkampfgetöse. Denn wenn die SPD ihre Politik tatsächlich korrigieren möchte, dann könnte sie schon jetzt entsprechende Anträge in die Bürgerschaft einbringen. Zum Beispiel für die Abschaffung der Ein-Euro-Jobs und deren Ersatz durch reguläre Arbeitsplätze.
Verwendung: Wochenzeitung Unsere Zeit vom 15.12.07, Seite 2
23. November 2007
 Hamburger Linke setzt SPD unter Druck
Hamburger Linke setzt SPD unter Druck
In Hamburg gibt es derzeit einiges zu bestaunen: die Hafencity als des Kontinents größte Baustelle, eine imposante Ausstellung über die antiken Gräber von Paestum. Vor allem aber den Linksruck der SPD. Denn mit jedem Tag, da die Bürgerschaftswahlen am 24. Februar 2008 nun näher rücken, umwirbt SPD-Bürgermeisterkandidat Michael Naumann auch die nach links schlagenden Herzen immer offensiver. Gefragt, was er von Ein-Euro-Jobs halte, ließ er diese Woche an diesen kein gutes Haar. Ähnlich bizarr auch die Auslegung des Wahlprogramms der SPD in anderen Fragen: Ein Mindestlohn für Geringverdiener müsse nun her, ein Stopp der Privatisierungen, der Verzicht auf die Studiengebühren sowie eine kostenlose Kita-Betreuung. sagt der 65-jährige ehemalige Staatsminister aus dem Kabinett von Gerhard Schröder. Es sind halt Wahlkampfzeiten und da sagt der Kandidat zu allem ja.
Doch aus dem Umfragetief kommt Naumann trotzdem nicht. Vor Wochen polterte er noch gegen Die Linke, weil deren Forderung nach einer Rekommunalisierung der Kliniken Politik des letzten Jahrhunderts und aus der Mottenkiste der DDR gewesen wäre. Doch das half auch nicht. Die Meinungsforschungsinstitute geben ihm und seiner Partei seit Monaten nur magere 32 Prozent. Von vier auf fünf, dann auf sechs, schließlich sogar auf sieben bis acht Prozent stiegen hingegen die Umfragewerte für Die Linke.
Olaf Harms (DKP) auf Listenplatz 10
Dass deren Ergebnis am Wahlabend noch viel besser wird, dafür kämpft die
linke Spitzenkandidatin Dora Heyenn. Sie spüre auf Wochenmärkten und auf Veranstaltungen ein großes Interesse, sagt die 58-jährige Lehrerin und frühere schleswig-holsteinische Landtagsabgeordnete der SPD gegenüber der UZ. Mit ihrer alten Partei brach Heyenn, als Oskar Lafontaine das Handtuch warf. Glaubwürdigkeit habe es in der Regierungspolitik seitdem nicht mehr gegeben. Die Hamburger Linke werde sich auch deshalb an keiner Regierung beteiligen. Selbst wenn sie das Zünglein an der Waage wäre, sagt Heyenn. Doch selbst eine Tolerierung schlossen die 130 Delegierten eines Wahl-Parteitages Ende September weitgehend aus. Die könne es nur geben, wenn sich ein anderer Kandidat als der amtierende Bürgermeister Öle von Beust (CDU) auf das linke Sofortprogramm beziehe und dieses dann auch umsetze.
Deutlich wird diese Haltung auch an der Kandidatenliste. Denn auf den weiteren als aussichtsreich empfundenen Listenplätzen kandidieren der Wirtschaftswissenschaftler Joachim Bischoff und die bisherige Sprecherin der Hamburger Linken, Christiane Schneider, der Erwerbslosenvertreter Wolfgang Joithe, die Bauer-Betriebsrätin Kersten Artus, Mehmet Yildiz von der Föderation der türkischen Arbeitervereine (DIDF), die iranische Marxistin Zaman Masudi, der Ex-Grüne Norbert Hackbusch (er verließ seine Partei anlässlich des Kosovo-Kriegs) und DKP-Landeschef Olaf Harms.
Dass die Kommunisten die LINKEN unterstützen, das beschloss eine Mitgliederversammlung der DKP erst nach Aufstellung der Kandidatenliste. Hier wollte man zunächst abwarten, ob der Verzicht auf Regierungsbeteiligungen und die Absage weiterer Privatisierungen wirklich beschlossen werden. Entscheidungsrelevant war außerdem, ob sich die Orientierung auf offenen Listen“ und auf die außerparlamentarischen Bewegungen durchsetzt.
Nun sieht es freilich so aus, als wenn mit Harms auch ein Kommunist wieder in die Bürgerschaft einziehen könnte. Oberhalb eines Ergebnisses von acht Prozent wäre dies wahrscheinlich, heißt es aus dem linken Wahlbüro. Gute Chancen, Parlamentsmandate zu erringen, hat die DKP aber auch in Harburg und in Wandsbek. Denn hier kandidieren Kommunisten schon ab Platz 3 der jeweiligen linken Wahlvorschläge für die Bezirksversammlungen genannten Kommunalparlamente.
DKP unterstützt die Kandidatur von Die Linke
* Die DKP unterstützt die Kandidatur der Partei Die Linke bei den Wahlen zur Hamburgischen Bürgerschaft und zu den Bezirksversammlungen am 24.2.2008 und wird daher zu diesen Wahlen eine Eigenkandidatur nicht durchführen.
* Die DKP-Hamburg wird sich inhaltlich mit ihren eigenen politischen Forderungen und Aussagen in den Wahlkampf einbringen. Hierzu wird ein Wahlaktiv, bestehend aus unseren Kandidatlnnen sowie mindestens je einem Mitglied pro Grundorganisation gebildet und die Herstellung von eigenen DKP-Wahlkampfmaterialien (Plakat, Flugblätter) organisiert. Als weiteres zentrales Wahlkampfmaterial wird die Broschüre Hamburg – Stadt der Klassengegensätze gedruckt und in Umlauf gebracht.
* Die Gliederungen der DKP-Hamburg greifen aktiv in den Wahlkampf ein.
* Unser Ziel sind starke Fraktionen der linken und fortschrittlichen Kräfte mit einer klaren Orientierung auf die außerparlamentarischen Bewegungen
(Beschluss der DKP-Hamburg zu den Wahlen zur Bürgerschaft und zu den Bezirksversammlungen am 24.02.08 in Hamburg)
Verwendung: Unsere Zeit, Printausgabe 23.11.07, Seite 7
Permalink zu diesem Artikel, Kommentare lesen oder schreiben: hier
Eintrag versenden: hier
15. Juni 2007
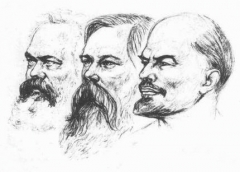
Auftaktveranstaltung mit 200 Teilnehmern – jetzt Veranstaltung mit Politikwissenschaftler Prof. Georg Fülberth
Als überparteilicher Bildungsverein, dessen Zweck ?im Studium und der Verbreitung des Marxismus“ besteht, hat sich vor Wochen eine neue Marxistische Abendschule (MASCH) für Hamburg gegründet. Mit großer Resonanz, wie schon die Auftaktveranstaltung zeigte. Vor 200 Menschen, darunter viele Jugendliche, Gewerkschafter, Betriebsarbeiter und Erwerbslose las der Schauspieler Rolf Becker im Arbeiterstadtteil Wilhelmsburg drei Stunden lang das ?Kommunistische Manifest“. Die Aufmerksamkeit war so groß, dass man eine Nadel, die auf den Boden fällt, hätte hören können. Dort in Wilhelmsburg soll nun auch die zweite größere Veranstaltung stattfinden. Zur politischen Aktualität des Kommunistischen Manifests spricht am 19. Juni der Politikwissenschaftler Georg Fülberth.
Doch das ist für den CDU-Politiker und Präsidenten des Hamburger Verfassungsschutzes, Heino Vahldieck, ein alarmierendes Zeichen. Kommunisten und ?Linksextremisten“ wären nun dabei ins ?Zentrum der politischen Unwägbarkeiten“ zu rücken, wusste daraufhin auch der Chefkommentator der Springer-Gazette Harburger Anzeigen und Nachrichten (HAN) zu berichten. Sie fürchten, dass gerade in Wilhelmsburg, einem der ?größten sozialen Brennpunkte“ der Stadt, schnell eine ?Sogwirkung“ für die Marxisten entstehen kann. Die flächendeckende Bespitzelung des neuen Vereins hat Vahldieck deshalb schon angeordnet.
Dass diese MASCH tatsächlich eine Sogwirkung entfaltet, dass zeigt aber auch die politische und soziale Zusammensetzung des Trägervereins. Angestoßen durch die örtliche Wohngebietsgruppe der DKP, ist der Verein gemeinsam mit Mitgliedern und Funktionsträgern der LINKEN, mit Gewerkschaftern, Jungsozialisten und vielen Parteilosen aus der Taufe gehoben worden. Darunter auch der Eurogate-Betriebsrat und ver.di-Schwerbehindertenvertreter Detlef Baade und der Vorsitzende des örtlichen Sozialverbandes, Ronald Wilken.
Sie alle halten Marx für notwendig, um zu verstehen, ?warum nicht nur der Reichtum, sondern auch die Armut wächst“. Aber auch um zu verstehen, warum diese Begriffe ?die Gesetzmäßigkeiten kapitalistischer Entwicklung“ nur unzureichend erklären – so deutete der ehemalige Hafenbetriebsrat und Kommunist Günter Feßler das starke Interesse an dem von ihm mit entworfenen Projekt. Dass die MASCH eine wichtige Rolle für eine stärkere Kommunistische Partei spielen kann, betonte indes Inge Humburg vom Gruppenvorstand der DKP. Viele Menschen würden heute nach einer Alternative zum Kapitalismus suchen. Doch dafür sei eben der Weg über einen überparteilichen Bildungsverein zunächst der leichtere.
Dass diese Anfangserfolge schnell verblassen, hofft nun der Bürgerschaftsabgeordnete der CDU, Ralf-Dieter Fischer. In den Medien betonte er: Marx und Engels sind ?tot“. Sie ?auszugraben und zu sezieren“ mache keinen Sinn. MASCH-Vorstandssprecher Tilo Schönberg will demgegenüber aber nun das Kursangebot eher noch ausweiten. ?Für die gesamte Metropolregion“ und mit speziellen Angeboten für Betriebsarbeiter. Geplant ist auch ein Lesezirkel zu ?Lohn, Preis und Profit“, jenem legendären Vortrag von Marx, den dieser schon 1865 vor dem Generalrat der I. Internationale hielt.
[Die Veranstaltung mit Prof. Fülberth findet am 19. Juni um 19 Uhr im Bürgerhaus Wilhelmsburg, Mengestraße 23 statt. Nähere Infos über www.masch-wilhelmsburg.de]
Verwendung: Wochenzeitung „Unsere Zeit“,15. Juni 2007
Permalink zu diesem Artikel, Kommentare lesen oder schreiben: hier
Eintrag versenden: hier
15. Juni 2007
ITF-Aktionswoche gegen Billigflaggenschiffe
Mit einer Aktionswoche in 15 Ländern Nordeuropas, gelang es der Internationalen Transportarbeiterföderation (ITF) vom 4. bis 8. Juni Druck auf so genannte Billigflaggenschiffe auszuüben. Denn gemeinsam mit den Hafenarbeitern wurde die Entladung dann für die Schiffe gestoppt, die keinen gültigen Tarifvertrag vorweisen konnten. Allein in den deutschen Seehäfen betraf das rund 100 Schiffe.
Zum Beispiel das unter liberianischer Flagge laufende Containerschiff Eleranta“. Als es am Hamburger Burchardkai angelegt hatte, bewirkte schon die Androhung eines Boykotts wahre Wunder. Denn sofort erklärte sich der Reeder bereit einen Tarifvertrag mit der ITF für das Schiff zu unterzeichnen. Gleich mehrere Stunden dauerte indes der Boykott für die in Wismar eingelaufene Smaragd“. Für dieses unter der Flagge Antiguas laufende Schiff, konnte der Kapitän zwar einen Tarifvertrag vorweisen, doch die ITF-Kontrolleure mussten feststellen, dass dieser einfach nicht eingehalten wird. Erst als der Reeder versicherte Heuer nachzuzahlen und auf Betrugsmanöver aller Art künftig zu verzichten, wurde das Schiff schließlich entladen. Wie wirksam solche Aktionen sind, das zeigte sich auch beim Großfrachter SCAV Libra Copacabana“. Unter dem Druck der Aktionen, unterzeichnete hier ein deutscher Reeder den Tarifvertrag nun schon, als sich das Schiff selbst noch auf hoher See und erst in der Anfahrt auf Rotterdam, Hamburg und Antwerpen befand. Schwieriger war es hingegen mit der CMA CGM Iguacu“. Wie ernst es den Hafenarbeitern mit ihrer Solidarität gegenüber den Seeleuten ist, konnte hier der Reeder erst begreifen, nachdem das Schiff sowohl in Rotterdam, wie dann auch in Hamburg boykottiert worden war. Lehrgeld dieser Art, musste aber auch die deutsche Großreederei Leonhardt & Blumberg (L&B) zahlen. Ihr Schiff, die Hansa Augustenburg“, wurde weder in Polen und noch in Rostock abgefertigt.
Nur so kann aber bei Schiffen, die unter billiger Flagge laufen, ein Tarifvertrag auch durchgesetzt werden. Denn wenn die Seeleute selbst meutern“, dann gilt das Seerecht. Burmesische Matrosen kommen schon dann ins Gefängnis, nehmen sie auch nur Kontakt mit Gewerkschaften auf. Für die Reeder ein wahres Vergnügen, denn so liegt die monatliche Heuer, häufig nur bei 200, 300 oder 400 Dollar. Und weil bei den Billig-Schiffen auch die arbeitsrechtlichen Bestimmungen des Heimatlandes nicht gelten, müssen die Seeleute dann dafür auch noch extrem lange schuften. Demgegenüber will die ITF mit ihren Tarifverträgen, einen Mindestlohn von 1 550 Dollar für alle Seeleute durchsetzen.
Für Gewerkschaftssekretärin Barbara Ruthmann, sie vertritt die ITF bei ver.di, war die Aktionswoche ein voller Erfolg“. In Nordeuropa habe es nun insgesamt Hunderte solcher Boykottaktionen gegeben. Doch weltweit laufen 21 000 Schiffe unter billiger Flagge. Die deutschen Reeder sind mit 3 200 Schiffen dabei gut vertreten. ITF-Tarifverträge konnten aber erst für 8 200 Schiffe durchgesetzt werden. Diese Bilanz zu verändern, kann nur mit internationaler Solidarität gelingen.
Verwendung: Wochenzeitung „Unsere Zeit“, 15. Juni 2007
Permalink zu diesem Artikel, Kommentare lesen oder schreiben: hier
Eintrag versenden: hier
2. März 2007
Demonstration der Hafenarbeiter gegen drohende Privatisierung
Die Auseinandersetzung um den vom CDU-Senat geplanten Verkauf von 49,9 Prozent der Anteile der bislang städtischen Hamburger Hafen und Logistik AG (HHLA), spitzen sich zu. Am Donnerstag den 22.2. legten Tausende Hafenarbeiter mit Beginn der Frühschicht ihre Arbeit nieder. Bis in die Abendstunden hinein, lag alles still: Containerriesen wurden nicht abgefertigt, LKWs und Schienenfahrzeuge nicht beladen.
Das war der Ausgangpunkt der Protestaktionen, die dann ihren Fortgang in einer Betriebsversammlung nahmen. Eingeladen hatten dazu die Konzernbetriebsräte, dieses mit bundesweit rund 4 200 Mitarbeitern größten deutschen Hafenunternehmens. Die Krönung des Protesttages lag in einer sehr machtvollen Demonstration quer durch die Innenstadt und vorbei an der Wirtschafts- und Finanzbehörde zum Sitz des HHLA-Aufsichtsrats. Besonders laut wurde es dabei am Rathaus, wo die Verantwortlichen für den Ausverkauf der HHLA sitzen. Mit dabei auch DKP-Vorsitzender Heinz Stehr, der wiederholt die Kämpfe der Hafenarbeiter begleitet hat.
Wie groß die Wut der Docker ist, wurde indes schon auf der Betriebsversammlung deutlich, als HHLA-Konzernbetriebsratsvorsitzender Arno Münster den Kreis jener Finanzspekulanten und Heuschrecken“ nannte, die sich aktuell noch um den Aufkauf der Anteile bemühen. Dazu gehört der arabische Großkonzern Dubai Ports World, Allianz Capital Partners, die Finanzgruppe 3i und die australische McQuire-Bank. Doch Angebote haben auch Hochtief und die Bahn AG vorgelegt. Sie alle, so will es Finanzsenator Michael Freytag (CDU), sollen nun ihre Angebote noch präzisieren. Freytag erhofft sich davon einen Erlös von 1,5 bis zwei Milliarden Euro. Ursprünglich hieß es: dies sei notwendig um die Hafenanlagen der HHLA zu modernisieren.
Doch die Hafenarbeiter wiesen nach, dass dies gar nicht erforderlich ist, weil solche Modernisierungsinvestitionen aus eigener Kraft geschultert werden können. Auf der Betriebsversammlung hat dann HHLA-Vorstandschef Klaus-Dieter Peters bestätigt, dass der Umsatz des Unternehmens 2006 um weitere 20 Prozent auf rund eine Milliarde Euro im Jahr gestiegen ist. Erstmals, so Peters, werde auch ein Gewinn nach Steuern von über 100 Millionen Euro erwirtschaftet. Und die Tendenz sei steigend. Doch warum muss ein solches Unternehmen dann privatisiert werden, fragte ver.di-Landeschef Wolfgang Rose. Er jedenfalls sieht keinen vernünftigen Grund“ die HHLA dem Finanzkapital zum Fräße vorzuwerfen, während deren Gewinne dann im Stadthaushalt fehlen.
Doch Hamburgs Senatoren wechseln ihre Begründungen, wie andere das Hemd. Das Geld aus dem Erlös für die Anteile werde auch benötigt um neue Kaianlagen für die gesamte Hafenwirtschaft zu finanzieren, sagte Wirtschaftssenator Gunnar Uldall (CDU) erst kürzlich. Thomas Mendrzik, selbst Betriebsvorsitzender im Containerterminal Altenwerder, nannte das eine Zumutung. Nicht die HHLA sei für solche Infrastrukturinvestitionen zuständig, sondern die Stadt, die sich dieses Geld dann über Umlagen von privaten Hafenbetreibern auch wieder refinanzieren lassen müsse. Erschüttert stellte Mendrzik fest, dass bereits über Investitionen spekuliert werde, die erst in vielen Jahren aktuell würden. Nach Prüfung des Finanzplans von Uldall stellte der Betriebsrat fest, dass in etlichen Positionen nur mit dem Daumen geschätzt worden sei. Mendrzik nannte Uldall deshalb einen unfähigen Senator“, der zudem auch die Bürger belüge“.
So sieht es auch Bernt Kamin, der als Betriebsratsvorsitzender der Gesamthafenarbeiter den HHLA-Kollegen die solidarischen Grüße der anderen Hafenbetriebe überbrachte. Wir Hafenarbeiter sind stolz auf unsere gute Arbeit“, sagte Kamin, und schlussfolgerte daraus, dass deshalb niemand das Recht habe, die Arbeitsbedingungen der Docker so einseitig in Frage zu stellen. Wenn dies nun doch stattfinde, so habe dies auch mit großer Politik“ zu tun, die auch international nur noch auf Privatisierung setze. Bernt Kamin rief alle Hafenarbeiter dazu auf, sich an den Gegenaktionen zum G8-Gipfel im Juni zu beteiligen.
Verwendung: Wochenzeitung „Unsere Zeit“, 02.03.07, Seite 5
Permalink zu diesem Artikel, Kommentare lesen oder schreiben: hier
Eintrag versenden: hier
 Streik der Hamburger Hafenarbeiter gegen Privatisierung der HHLA
Streik der Hamburger Hafenarbeiter gegen Privatisierung der HHLA
Kraftvoll, kampfbereit und entschlossen haben Hamburgs Hafenarbeiter am 14. 12. den Plan des CDU-Senats, 49,9 Prozent der Anteile des mit 3 500 Beschäftigten größten Hamburger Hafenbetriebs, der Hafen und Logistik AG (HHLA), an einen Privatinvestor zu verkaufen, zurückgewiesen. Begründet mit einer Betriebsversammlung und dem Recht auf Information ruhte in allen Betrieben der HHLA von 6 bis 15 Uhr die Arbeit. Auf drei von vier der großen Containerterminals im Hamburger Hafen, standen alle Kräne still. Über 2 000 Hafenarbeiter demonstrierten stattdessen zunächst zum Rathaus und dann zum Sitz des HHLA-Aufsichtsrats.
Dass dies aber nur der Auftakt für weitere Proteste ist, wenn der Senat trotzdem an seinen Verkaufsplänen festhält, versicherte Konzernbetriebsratsvorsitzender Arno Münster. Wer die Hamburger Hafenarbeiter weiterhin an Edelheuschrecken“, wie etwa den Finanzspekulanten Dubai Ports World oder die Deutsche Bahn verscherbeln möchte, der müsse sich auf weitere Eskalationsstufen in diesem Kampf um die Zukunft des Hafens einstellen. Münster deutete dabei auch einen Dienst nach Vorschrift“ an, der dann zu dauerhafteren Verzögerungen bei der Schiffsabfertigung führen könnte.
Vor den Folgen einer solchen Privatisierung des bislang städtischen Unternehmens, hatte die Hafenarbeiter auf ihrer Belegschaftsversammlung auch Katharina Ries-Heidtke, Vorsitzende des Gesamtbetriebsrates im. Landesbetrieb Krankenhäuser (LBK), eindringlich gewarnt. Sie schilderte eindrucksvoll, wie nach der Privatisierung der Hamburger Krankenhäuser, dort nun Sozialdumping und Entlassungen bevorstehen. Das traf den Nerv der Docker, die laut und wütend am Rathaus vorbeizogen, um dort Bürgermeister Ole von Beust (CDU) zu sagen, dass sie sich derartiges nicht gefallen lassen werden.
Verdeutlicht hat diese Kampfbereitschaft auch ver.di-Landeschef Wolfgang Rose, der die Hafenarbeiter davor warnte, dass die Teilprivatisierung nur der erste Schritt in Richtung einer Totalzerschlagung ihres Unternehmens sein könnte. Neben dem Containerumschlag gehören bisher auch Betriebe im Bereich der Lager- und Kontraktlogistik sowie der Immobilienverwertung zur HHLA. Doch der Senat hat bereits erste Ausgliederungen im Zusammenhang mit dem Teilverkauf angekündigt.
Wir sind stolz auf unsere Arbeit und auf das wir tun, sagte Bernt Kamin, Betriebsratsvorsitzender im Gesamthafenbetrieb GHB auf einer Zwischenkundgebung in der Nähe des Rathauses zu den HHLA-Beschäftigten. Doch aus dieser guten Arbeit folgere dann auch, dass niemand das Recht hätte, die Arbeitsbedingungen für die Hafenarbeiter zu verschlechtern, sagte Kamin. Während er den Beschäftigten der HHLA die volle Solidarität aller anderen Hafenbetriebe versicherte, versprach er dem Senat, alles zu tun, damit die Privatisierung doch noch verhindert werden kann.
Verwendung: Wochenzeitung „Unsere Zeit“, 22. Dezember 2006, Seite 5
Wann schenkt Airbus seinen 57 000 Mitarbeitern (22 000 arbeiten allein in Deutschland) endlich reinen Wein ein? Diese Frage beschäftigte in der letzten Woche Airbus-Betriebsräte und Vertrauenskörperleitungen der IG Metall aus ganz Deutschland, die sich dafür zur Krisensitzung in Hamburg versammelt hatten. Nun wollen die Kollegen gemeinsam für den Erhalt ihrer Arbeitsplätze kämpfen, ohne sich dabei auf die Standortkonkurrenz ihres Managements einzulassen.
„Wenn einer von uns angegriffen wird, sind wir aber alle angegriffen“, sagte dazu Thomas Busch, stellv. Vorsitzender des Gesamtbetriebsrats (GBR). „Wir sind nicht bereit, einzelne Auswirkungen aus dem Kostenreduzierungsprogramm ´Power 8´ zu verhandeln, ohne dass wir das gesamte Ausmaß im Airbus-Konzern kennen“, unterstrich dies auch der Hamburger Betriebsratsvorsitzende Horst Niehus, der zudem eine vollständige Offenlegung aller Planungen im Management des Airbus-Mutterkonzern EADS einforderte.
Für die eingeforderten Verhandlungen hat die Sicherung der Arbeitsplätze in den einzelnen Standorten für die Betriebsräte oberste Priorität. Aber auch um die Qualität ihrer Arbeitsplätze, die Bewahrung arbeits- und sozialrechtlicher Standards sowie die Einhaltung vertraglicher Regelungen über die Arbeitsaufteilung zwischen Deutschland und Frankreich wollen die Betriebsräte kämpfen. Eine notwendige Strategie, denn wie die EADS-Manager Beschäftigte, aber auch Steuerzahler austricksen, wurde spätestens beim Krisengipfel in Berlin klar. Während sich EADS-Co-Chef Tom Enders in Berlin für den Erhalt der Standorte in Hamburg, Nordenham, Bremen, Varel, Buxtehude und auch in Stade aussprach, erklärte Damals-noch-Airbus-Konzernchef Christian Streiff in Paris eher Gegenteiliges. Standortschließungen könnten auch in Deutschland nicht ausgeschlossen werden, verkündete er.
Alle Pläne müssen auf den Tisch, forderte deshalb nun auch der GBR-Vorsitzende Rüdiger Lütjen, der aber durchaus auch Kompromissbereitschaft, etwa bei den Arbeitszeiten, andeutete. Auch dies entspricht einem Positionspapier der Betriebsräte, in dem diese die Globalstrategie von EADS genauso verteidigen, wie etwa die Orientierung des Konzerns auf Großraumraumflugzeuge oder den systematischen Ausbau des Rüstungssegments bei Airbus und EADS. Nur von „Strukturproblemen“ wollte Lütjen reden, die durch Fehlplanungen im Management entstanden seien.
Doch solche Produktionsschwierigkeiten, die zu Lieferverzögerungen beim A 380 und der Airbus-Krise führten, haben durchaus auch etwas mit der EADS-Eigentümerstruktur und dessen vielfacher Abhängigkeit von Rüstungsaufträgen der Regierungen in Berlin und Paris, aber auch in London und Madrid zu tun. Dass etwa 12 Milliarden Euro für die Entwicklungskosten des A 380 übernommen werden konnten, wäre etwa ohne eine gleichzeitige Nutzung solcher Forschungsergebnisse für den Militärtransporter A 400 M, völlig undenkbar gewesen. Doch nun erhöhen sich die Kosten um weitere 5 Milliarden Euro, die an Fluggesellschaften wegen der Lieferverzögerungen zu zahlen sind. Ob dann aber noch der A 380 jemals in die Phase der Serienproduktion tritt, bleibt trotzdem unklar, denn 2007 kann nur ein einziger A 380 ausgeliefert werden, während allein zur Kapitalamortisation mindestens 400 dieser Fluggiganten verkauft werden müssten. Doch sind nur 159 Flugzeuge bestellt und Großabnehmer, wie die Emirate Airline, denken schon jetzt über einen Wechsel zu Boeing nach. Deshalb befürchten nun auch Wirtschaftsanalytiker, dass sich EADS von rund 40 Prozent seiner Airbus-Produktionskapazitäten trennen könnte, was dann vor allem für Hamburg eine Riesenpleite wäre, wo die Stadt fast 1 Milliarde Euro für den Ausbau des Airbus-Ports schon jetzt investiert hat.
Kurz vor Redaktionsschluss dieser Ausgabe wird der Rücktritt von Konzernchef Christian Streiff bekannt gegeben. Der neue Airbus-Chef Louis Gallois will dort weiter machen, wo Streiff aufhörte mit konzernweiter Arbeitsplatzvernichtung. Der sogenannte Sanierungsplan „Power8“ soll „sofort“ umgesetzt werden, was die Zukunft nicht nur der 12 500 Hamburger Airbus-Beschäftigten in Frage stellt. Der notwendige Kampf um den Erhalt der Arbeitsplätze geht also in eine neue Runde.
Quelle: Wochenzeitung „Unsere Zeit“, 13.10.06, Seite 1 (Titel)
Ausstellung zum KPD-Verbot eröffnet
Unmittelbar nach der Thälmann-Ehrung wurde am letzten Freitag die vierwöchige Sonderausstellung zum 50. Jahrestag des KPD-Verbots in der Hamburger Gedenkstätte Ernst Thälmann eröffnet.
Gedenkstättenleiter Uwe Scheer wollte so auf die historische Kontinuität antikommunistischer Verfolgung „seit den Prozessen 1852 zu Köln“ hinweisen. In Abwandlung eines Thälmann-Worts hatte Fördervereinsvorsitzender Hein Pfohlmann zuvor aber gesagt, dass von Gedenktagen auch „eine Ausstrahlung auf die heutige Kämpfe“ ausgehen müsse.
Das unterstrich auch Zeitzeuge Ewald Stiefvater, ehemaliger DKP-Vorsitzender in Schleswig-Holstein, der bis ´56 zum Redaktionskollektiv der Hamburger Volkszeitung gehörte. Das Verbot sei ein bisher nicht gesühntes „politisches und juristisches Verbrechen“ erster Güte. Doch noch wichtiger sei es, dass es – wie ein Damoklesschwert – auch heute die gesamte Linke bedrohe. Wie Kurt Erlebach, ehemaliger KPD-Bürgerschaftsabgeordneter, unterstrich auch Stiefvater, dass Schluss sein müsse mit jener „verlogenen Zeit“ der 50er Jahre, die durch primitivsten Antikommunismus, aber auch durch die faktische Rehabilitierung der Nazi-Verbrecher gekennzeichnet gewesen sei. Eindringlich forderten Erlebach wie auch Stiefvater die „Rehabilitierung aller Opfer“.
Die Verbindung mit der Zeit der Berufsverbote schlug dann Horst Bethge, ehemaliger Sprecher der Bewegung gegen diese, heute Landessprecher der Linkspartei in Hamburg. Er zog Vergleiche, benannte aber auch Unterschiede. Im Kampf gegen die Berufsverbote sei es besser gelungen, juristische und politische Kämpfe sowohl auf betrieblicher, lokaler, wie auf parlamentarischer und internationaler Ebene miteinander zu verknüpfen. In ähnlicher Weise müsse nun heute auch das KPD-Verbot zum Thema aller linken und demokratischen Kräfte sowohl auf nationaler wie auf internationaler Ebene werden. Doch dafür müsse noch besser erklärt werden, weshalb dies auch für heute von Bedeutung ist. Staatliche Repression bekämpfe man am Besten, wenn man sich gemeinsam „für die unteilbaren Freiheits- und Bürgerrechte“ einsetze. Die Aufhebung des Verbots sei auch heute bedeutsam, da damit ein Bruch mit der alten, nur auf Antikommunismus basierenden Gesellschaftskonzeption der Bundesrepublik zu erreichen wäre.
Wie Berufsverbote-Opfer Ilse Jacob erinnerte Bethge in diesem Zusammenhang auch daran, dass die Mehrzahl der Länder die Berufsverbote noch gar nicht aufgehoben, sondern nur ausgesetzt hätten. Wie beim KPD-Verbot stehe die materielle Entschädigung für die meisten Opfer, noch gänzlich aus.
Eine interessante Debatte, die Gedenkstättenmitarbeiterin Elisabeth Sukowski da mit ihrer Ausstellung nun angestoßen hat. Fast nur auf historischen Originaldokumenten beruhend, ist diese noch bis zum 18. September zu sehen.
http://www.dkp-online.de/uz/3834/s0701.htm
Zu diesem Thema finden in vielen Städten Veranstaltungen statt. So lautet auch der Titel einer vierwöchigen Sonderausstellung in der Hamburger Gedenkstätte Ernst Thälmann, Tarpenbekstraße 66.
Illustriert werden Verbotsverfügungen für kommunistische Zeitungen in der Nazi-Zeit, Berufsverbote aus dem Jahr 1934, die Verhaftungswellen gegenüber Kommunisten und Sozialdemokraten. Fotos, Briefe, Gerichtsakten und illegale Flugblätter zeigen aber auch, dass selbst in dieser Zeit der Kampf der Kommunisten für ein demokratisches Deutschland niemals aufhörte. Im Zeitraffer folgen dann Dokumente aus der Nachkriegszeit, als diese Widerstandskämpfer, auch in Senat, Verwaltungen und Betrieben, zu den ersten Akteuren eines demokratischen Aufbruchs gehörten. Auf einem weiteren Foto ist zu sehen, wie sich die Landesvorsitzenden von KPD und SPD über den Gräbern des Ohlsdorfer Friedhofs die Bruderhand reichen.
Der Hauptteil der Ausstellung widmet sich indes den Jahren unmittelbar vor und nach dem KPD-Verbot 1956. Hier besticht die Ausstellung durch zahlreiche Originaldokumente, wie etwa Artikel aus der kommunistischen Hamburger Volkszeitung“ oder dem Blinkfuer“, anhand derer sich Besucher in die Debatten der damaligen Zeit hineinversetzen können. Verfolgung hatte Namen, auf Täter-, wie auf Opferseite, das zeigen schließlich Fotos, Gerichtsakten, und persönliche Briefe, die auch verdeutlichen, wie Repressalien (so etwa die Beschränkung der Reisefreiheit) selbst Familienangehörige trafen. Übersichtlich werden Gerichtsurteile und (teilweise lange) Haftzeiten von etwa 120 KPD-Mitgliedern dokumentiert. Doch auch für diese Zeit verdeutlichen Dokumente, dass sich der Widerstand der Kommunisten gegen die Remilitarisierung Westdeutschlands trotzdem fortsetzte. Bilder und Gerichtsakten aus der Berufsverbotszeit in den Siebziger- und Achtzigerjahren, runden dieses Angebot für eine interessante und lebendige politische Bildungsarbeit schließlich ab.
Öffnungszeiten: Montag: 17-20 Uhr, Mittwoch bis Freitag 10 bis Uhr, Samstag von 10 bis 13 Uhr. Gruppen/Schulklassen können auch Sondertermine vereinbaren.
http://www.dkp-online.de/uz/3833/s0103.htm
Computer-Wurm Sober Q verweist auf NPD-Webseiten
Pünktlich zum Pfingstwochenende, als Administratoren Urlaub machten und Otto-Normalbürger viel Zeit hatte E-Mails zu lesen, begann eine neonazistische und ausländerfeindliche Propagandaschlacht: Hunderttausende Propaganda-Mails dürften inzwischen verschickt worden sein und die Flut lässt nicht nach. Mit Geschichten von „bevorzugten“, „steuerhinterziehenden“ Ausländern und „abgezockten Deutschen“ wird Tage vor der Landtagswahl in NRW Stimmung gemacht.
Die letzte rechte Spamwelle (im letzten Sommer) wurde durch die Computerwürmer Sober G und H erzeugt. Schließlich machte Sober P beim WM-Ticket-Verkauf Furore. Niemand fragte damals nach den Urhebern, den eigentlichen Gründen der Attacke. Jetzt ist es klar: mit Sober P infizierte PC bilden das anziehende Nest für die neueste Wurmversion Sober Q. Mit einem Triggerdatum ausgestattet, war so sichergestellt, dass genau am 15. Mai um 0.00 Uhr die Spam-Routine langsam begann. Infiziert sind vor allem PC mit Windows-Betriebsprogrammen. Die rechte Nachrichtenflut trifft Geschäftsaccounts (wie den Otto-Versand in Hamburg) und solche, die im Internet abzugreifen sind. Nutzer von Freemail-Angeboten, bleiben hingegen verschont. Betroffen sind auch Mailing-Portale von Sozialforen und Sozialbündnissen.
Die politische Wirkung ist nicht zu unterschätzen, wenn jetzt zum Beispiel unter dem Label von Tagesthemen-Chef Ulrich Wickert rechtsextreme Texte empfohlen werden, in denen „Transparenz bei Einkünften der Spitzenpolitiker“ gefordert wird, oder wenn – unter dem Label von Gewerkschaftsfunktionären, Behörden, Bürgerinitiativen oder Einzelpersonen – auf das Schicksaal der „deutschen Frau“, die „Verbrechen der Bombardierung Dresdens“, die „4,8 Millionen Osteuropäer im Lande“ oder den Fischer-Volmer-Erlass hingewiesen wird. Geschickt wird dabei nicht nur auf Web-Seiten der NPD, sondern auch auf seriöse Quellen in Zeitungen oder im Fernsehen verwiesen. Ein gefährlicher Mix.
Allein das Programmieren, die aufwändige und professionelle Zusammenstellung von griffigen Schlagzeilen, die Bearbeitung der Betreffzeilen und Links erforderte erhebliche Vorbereitungspower. Diese Propaganda-Welle ist lange vorbereitet! Zunächst wurden Tausende PC mit dem Fußball-Wurm Sober P infiziert. Dieser wirkt wie eine Brutstelle für Sober Q, der sich – vom User unbemerkt – nun als Spamschleuder betätigt. Die WM-Ticket-Masche verleitete Hunderttausende Mailempfänger bedenkenlos Sober-Mail zu öffnen, führte dazu, dass wirkliche Intentionen verdeckt blieben und auch kaum jemand danach fragte. So als käme das Ganze aus dem digitalen Nichts. Einschlägige Anbieter von Antivirenprogrammen übersahen schließlich, dass Sober P über eine Funktion verfügt, mit der weitere Schadprogramme nachzuladen sind.
Auch wenn der Zeitpunkt der Spamwelle mit der Landtagswahl zu tun hat, ist das Ganze doch weit darüber hinaus konzipiert. Inzwischen erreichen die Spam auch englischsprachige Leser. Betreffzeilen sind übersetzt und es wird auch auf englischsprachige Texte verwiesen.
Die scheinbaren Absender der Mails wissen dabei gar nicht, was unter ihrem Namen passiert. Auch technisch besteht kein Zusammenhang. Sober durchsucht Adressverzeichnisse infizierter PC, nutzt die darin enthaltenen Adressen für den Versand. Einen Schaden im System richtet der Wurm dabei nicht an. Jedoch ist Web-Teilnehmern mit hohem Mail-Aufkommen oder großen Adressverzeichnissen dringend ein Update des Anti-Viren-Programms anzuraten. So könnte die braune Welle eingedämmt werden. Kein wirklicher Trost kann es hingegen sein, dass die Homepage der NPD bereits gestern unter der Last der Aufrufe zeitweise in die Knie ging. Der sonst recht aktive Verfassungsschutz tappt übrigens völlig im Dunkeln.
http://www.dkp-online.de/uz/3721/s0702.htm
Widerstand gegen Konsum- und Castingwahn
Am 10. Januar 2005 zeigte ein erhöhtes Polizeiaufkommen im Hamburger Schanzenviertel für jeden deutlich an: der Umbau des Wasserturms im Schanzenpark hat begonnen. Seit vielen Monaten wehren sich die Anwohner der Schanze, dass ihr Wahrzeichen in ein Mövenpick-Hotel verwandelt werden soll. 40 Millionen Euro will die Augsburger Firma Patrizia dafür aufwenden. Diese plant ein Hotel mit 226 Zimmern, Fitnesscenter und Restaurant. Dagegen organisiert ein „Freies Netzwerk für den Erhalt des Schanzenparks“ seit Mitte letzten Jahres Aktionen und Demonstrationen, oft begleitet durch ein Großaufgebot der Polizei. 1 100 Demonstranten war es allein beim Baubeginn. Inzwischen gleicht die Baustelle einer Festung mit hohen Zäunen und Stacheldraht. Wer sich dem Areal nähert erhält Platzverweis. Doch zum 5. Februar hat die Initiative erneut zu einer Großdemonstration an der Sternschanze aufgerufen.
Die Initiative befürchtet, dass der acht Hektar große Schanzenpark in dem der Wasserturm liegt, nach dem Bau des Hotels für viele Menschen nicht mehr nutzbar ist. Hier treffen sich die Menschen aller Altersstufen und Herkunft vor allem im Sommer, werfen Frisbee-Scheiben, grillen und spielen Fußball. Das soll so bleiben, sagt das Protest-Netzwerk in einer Stellungnahme. Schon jetzt nach dem Baubeginn würden Menschen afrikanischer Herkunft verdrängt. Man unterstelle ihnen pauschal als Dealer tätig zu sein. Der Park sei der einzige verbliebene Ort im Stadtteil, der noch nicht Teil des Konsum- und Castingwahns ist, wie er in der Schanze Einzug gehalten habe.
Die Schanze ist seit Mitte der 80er Jahre Treffpunkt der links-alternativen Szene. In dem ursprünglich eher proletarisch geprägten Viertel entstanden linke Projekte und Buchläden, Kneipen und Geschäfte. Häuser, die zum Abriss vorgesehen waren, wurden besetzt. Hier liegt die „Rote Flora“, kultureller Treffpunkt der Autonomen. Zum Bild des Stadtteils gehören auch zahlreiche ausländische Bewohner, mit ihren Geschäften und Cafés. Doch längst hat ein Umstrukturierungsprozess eingesetzt. Vom Pferdemarkt kommend zeigt die Schanze ihr neues Gesicht: Häuser mit erkennbar teuren Wohnungen. Mobilfunkläden und Edel-Boutiquen, Grafik- und Werbeagenturen prägen das Bild. Überteuerte Öko-Märkte verweisen auf die Bedürfnisse grüner Wohlstandsbürger. 110 Millionen Euro hat die Stadt für Sanierungsmaßnahmen investiert. Aus dem linken Schmuddelkind ist so längst ein angesagter Stadtteil geworden. Dagegen gibt es seit langem Widerstand, der sich jetzt bei der Auseinandersetzung um den Wasserturm kumuliert. Man wolle, sagt das Bündnis, den Protest auch als solchen gegen die Privatisierung öffentlicher Räume verstanden wissen. Zudem sei das Hotelprojekt Teil der Konzeption der „wachsenden Stadt“, mit der die regierende CDU ihre kommunalpolitischen Ziele umschreibt. Diese Konzeption setze auf Verdrängungsprozesse in verschiedenen Stadtteilen.
http://www.dkp-online.de/uz/3706/s1202.htm
Rechtliche Situation, Gegenwehr und Alternativvorstellungen – aus einem Vortrag im Erwerbslosenrat Hamburg
600 000 bis 1 Million Ein-Euro-Jobs will die Regierung in 2005 einführen. 10 000 sind es in Hamburg, 12 000 in Dortmund, 50 000 in Berlin. ALG-II-Bezieher sind verpflichtet diese rechtlosen Arbeitsgelegenheiten (ohne Vertrag, Kündigungsschutz oder Entgeltfortzahlung) anzunehmen. Die Mehraufwandsentschädigung beträgt einen, maximal zwei Euro pro Stunde. Viele der Jobs entstehen in Wohlfahrtsverbänden, Krankenhäusern, Schulen, Kitas und im öffentlichen Dienst. Mancherorts gehen klassische Beschäftigungsträger leer aus, anderenorts bilden sie Schnittstellen.
Mit den Ein-Euro-Jobs wird das klassische Mittel zur „Überprüfung der Arbeitswilligkeit“, wie es im BSHG schon vorgesehen war, auf alle Arbeitslosen übertragen. Wer sich weigert, riskiert Leistungskürzungen. Ein-Euro-Jobs flexibilisieren den Arbeitsmarkt. Als Billig-Jobber drücken sie die Löhne. Kostenneutrale Arbeit ist im öffentlichen Sektor gefragt, um Finanzierungsverluste zu kompensieren. So sollen Kindergärten, Krankenhäuser, Sozialstationen und soziale Dienste billiger werden.
Außer dem Recht auf Urlaub und Arbeitsschutz haben Ein-Euro-Jobber keine Rechte. Das beginnt schon bei der Zuweisung durch das Arbeitsamt. Fehlende Eingliederungsvereinbarungen können durch Verwaltungsakt ersetzt werden. Auf Möglichkeiten der individuellen Gegenwehr haben Tacheles e. V. und andere Initiativen verwiesen. Dort gibt es gute Muster für die Begründung individuellen Widerspruchs. Doch eine aufschiebende Wirkung hat das nicht. Deshalb sollten Widersprüche mit der Gewerkschaft oder dem Sozialverband besprochen sein.
Möglichkeiten von Betriebs- und Personalräten
Kollektivere Gegenwehr ergibt sich aus den Mitwirkungsmöglichkeiten der Betriebs- und Personalräte. Nach dem Sozialgesetzbuch ( SGB ) II müssen Kriterien eingehalten werden: öffentliches Interesse, Zusätzlichkeit, Wettbewerbsneutralität und arbeitsmarktpolitische Zweckmäßigkeit. So soll verhindert werden, dass reguläre Arbeitsplätze verdrängt werden und Dumpingpreise bei Gütern und Dienstleistungen greifen. Arbeitsmarktpolitische Zweckmäßigkeit soll die Vermittlungschance verbessern. Betriebs- und Personalräte haben bei der Einstellung von Ein-Euro-Jobbern ein Mitbestimmungsrecht, denn die betriebliche Integration gilt arbeitsrechtlich als Einstellung, auch unabhängig vom Arbeitnehmerstatus. Deshalb können und sollen sie prüfen, ob die Kriterien erfüllt sind. Die Prüfung kann an Hand der Betroffenheit der eigenen Belegschaft erfolgen. Ein Informationsrecht besteht schon bei der Planung. Das gilt auch, wenn Jobber über private Träger kommen. Auf die Weisungsgebundenheit kommt es an. Wenn die SGB-II-Kriterien nicht erfüllt sind oder negative Auswirkungen (Arbeitsplatzgefährdung) zu befürchten sind, sollten Betriebsräte der Einstellung widersprechen.
Sind Ein-Euro-Jobber erst mal integriert, stellt sich die Frage, wer für ihre Interessenvertretung zuständig ist? Aus der Weisungsgebundenheit ergibt sich ein arbeitnehmerähnlicher Status. Zwar haben Ein-Euro-Jobber bei Betriebsratswahlen keine Rechte, auch bei der Größe des Betriebsrates und der Anzahl von Vollfreistellungen werden sie nicht mitgezählt, aber wenn ein Betriebsrat Mehrarbeit hat, ist eine aus dem Anlass bezogene Freistellung möglich.
Die Prüfung der SGB-II-Kriterien ist auch auf der kommunalen Ebene ein wichtiger Hebel, um Ein-Euro-Jobs zu widersprechen. Doch gleichzeitig benennt das SGB II eine Menge von Ausnahmen und der Gesetzgeber kündigt an, die Kriterien zu liberalisieren. Jede Einsparung bei öffentlichen Dienstleistungen schafft zusätzlichen Interpretationsraum. Die Grenzen zwischen zusätzlicher und regulärer Arbeit werden schwammig. Arbeitsmarktpolitische Zweckmäßigkeit ist durch die Vergabe schon auf den Kopf gestellt. Maximal 500 Euro monatlich Fallkostenpauschale zahlt die Agentur für Arbeit pro Jobber. Nach Abzug der Mehraufwandsentschädigung, verbleiben 300 Euro. Deshalb gab es in Hamburg für 10 000 Stellen 20 000 Angebote. Den Zuschlag erhalten die Billigsten. Qualifizierung gerät unter die Räder eines gnadenlosen Anbieterwettbewerbs.
Niedriglöhne und Deregulierung kennzeichnen zunehmend auch den ersten Arbeitsmarkt: Leiharbeit, 8 Millionen Mini-Jobs, zwei Millionen Vollzeitbeschäftigter im unteren Armutsbereich. Mit Ein-Euro-Jobs werden Menschen diszipliniert Arbeit anzunehmen: egal unter welchen Bedingungen. Wo jede Arbeit zumutbar und erzwungen werden kann, wird die Gelegenheit zu arbeiten selbst zum Lohn. Verteilungsgerechtigkeit und Einkommensstrukturen sollten unsererseits ins Zentrum der Debatte rücken, denn staatliche Aktivierung exerziert nur vor, was Standard werden soll. In diesem Zusammenhang ist die Diskussion um einen Mindestlohn ein wichtiges Arbeitslose und Beschäftigte verbindendes Element. Da sich die Degradation größerer Teile der arbeitenden Bevölkerung in der öffentlichen Daseinsvorsorge vollzieht, muss die einkommenspolitische mit einer Qualitätsdebatte kombiniert sein.
Der dritte Arbeitsmarkt erfordert politische Antworten
Gegenmacht erfordert strategische Allianzen. Sonst steht demnächst auch bei Aldi oder im Hafen der Ein-Euro-Jobber. Um strategische Allianzen zu bilden, müssen zunächst neue Formen der politischen Interessenvertretung für Ein-Euro-Jobber gefunden werden. Die sichtbare Not, die sich darin ausdrückt, dass sich viele auch freiwillig auf solche Jobs bewerben, ist dafür ein weiterer Grund. In Hamburg sollte sich der Erwerbslosenrat, unterstützt durch die Gewerkschaft, für zuständig erklären. Das grundsätzliche „Nein“ zu den Ein-Euro-Jobs müssen wir verbinden mit dem Kampf um jeden Zentimeter der politischen und ökonomischen Gestaltung. Das fängt mit dem Ticket für den Nahverkehr an, reicht schließlich bis zu der Forderung rechtlose durch sozialversicherungspflichtige Beschäftigungsverhältnisse zu ersetzen. Politische Interessenvertretung bildet sich hier nicht nur durch Selbstorganisation, sondern bedarf nachhaltiger Impulse von außen. Zugleich entsteht damit ein bündnispolitischer Rahmen, bei dem wir auch fragen: Was ist mit der Qualität öffentlicher Dienstleistung? Bündnispartner sind auch die Kernbelegschaften und die Gewerkschaften, die Billig-Konkurrenz fürchten. Eine Forderung könnte darin bestehen, die Differenz zwischen ALG II, Mehraufwandsentschädigung und Leistungen für die Unterkunft einerseits und ortsüblichen Löhnen andererseits durch Zuschüsse der Stadt, des Landes, der Träger auszugleichen. Die Debatte um die Freiwilligkeit gewinnt an Plausibilität, wenn wir fragen, ob ernsthaft Unfreiwillige Pflegebedürftige pflegen sollen?
Nähere Informationen zu den Mitbestimmungsmöglichkeiten für Betriebs- und Personalräte, finden Sie im Internet unter: www.verdi.de/recht_mitbestimmung. Musterexemplare für einen Widerspruch finden Sie bei Tacheles e. V. unter www.tacheles-sozialhilfe.de. Ebenfalls auf den Seiten des Vereins zur Förderung der Sozialhilfeberatung unter www.sozialhilfe-online.de.
http://www.dkp-online.de/uz/3705/s0402.htm
[Die nachfolgende Titelstory für die Wochenzeitung „Unsere Zeit“ wurde gemeinsam mit Chefredakteur Rolf Priemer verfasst.]
10 000 Menschen haben am Samstag gegen einen Nazi-Aufmarsch in Kiel demonstriert, den Oberbürgermeisterin Angelika Volquartz (CDU) nicht verbieten wollte. „Dies ist unsere Stadt! Hier ist für Faschisten kein Platz! Wer ihnen den öffentlichen Raum zur Verfügung stellt, wird auf Widerstand stoßen“, so hieß es in einer Erklärung der Organisatoren des „Runden Tisches gegen Rassismus und Faschismus“ in Kiel. Auch in Dörvelden bei Bremen gingen 2 000 Menschen gegen die Neonazis auf die Straße. Ebenfalls im thüringischen Schleusingen, in Gera, Leverkusen und anderen Orten.
„Zwei Tage nach dem 60. Jahrestag der Befreiung des von den Hitlerfaschisten betriebenen Konzentrations- und Vernichtungslagers Auschwitz wurde bekennenden Nationalsozialisten erlaubt“, in Kiel zu demonstrieren – so der „Runde Tisch“ in einer Erklärung. „Gegen Multi-Kulti und Hartz IV – das Volk sind wir“, so hatten „Freie Nationalisten“ ihren Aufmarsch angekündigt, den auch die NPD wochenlang beworben hatte. Kurzfristig sagte sie ihre Unterstützung ab, denn alle Kräfte seien im Wahlkampf gebunden. Reine Taktik, um Wähler nicht abzuschrecken, sagte Alexander Hoffmann vom Runden Tisch, der auf mehrere NPD-Kandidaten unter den 350 Marschierern verwies.
Um am 20. Februar in den Landtag einzuziehen, will die NPD Kräfte bündeln: Nicht nur bei der DVU und anderen Rechtsparteien, auch bei den „Freien Kameradschaften“. „Arbeit zuerst für Deutsche“, „Wahltag ist Zahltag – auch für Hartz IV“ so wirbt die NPD um Wählerstimmen. Soziale Demagogie und Rassismus sollen per Wahlzeitung in alle Haushalte getragen werden. In Kiel sprach jetzt Thomas Wulff, Chef der „Freien Kameradschaften“, vom „Raub deutscher Arbeitsplätze“, die auch NPD-Funktionärin Daniela Wegener nur für „deutsche Volksgenossen“ will. Ein Wahlplakat zeigt Frauen mit Kopftüchern, die Plastiksäcke schleppen. Ausländer müssten „zurückgekehrt werden“ heißt es im NPD-Programm. „Gute Heimreise“ titelt das Plakat.
Die Provokationen der Hitler-Nachfolger nehmen zu. Aus dem Aufmarsch der 300 in Kiel heraus wurde gerufen: „Ein Volk, ein Führer – die letzte Hoffnung für unser Land!“ Auf einer Demonstration in Leverkusen hieß es: „Die schönsten Nächte sind aus Kristall“ und „Nie wieder Israel“. Auch grölende Rockbands heizen die Stimmungen an, so die Gruppe „Oidoxie“: „Hisst die rote Fahne mit dem Hakenkreuz“. Oder die „Weißen Wölfe“: „Juda verrecke und Deutschland erwache“. Ungestraft ist auch das zu hören: „Für unser Fest ist uns nichts zu teuer – Zehntausend Juden für ein Freudenfeuer!“
Mit diesen und anderen Parolen haben Neonazis ihren Einfluss ausgebaut. Bei den Europa- und den Kommunalwahlen. Vier Prozent für die NPD gab es bei den Landtagswahlen im Saarland. 9,2 Prozent in Sachsen. Im „Deutschland-Pakt“ haben sich NPD und DVU nun das Ziel gesetzt 2006 in den Bundestag einzuziehen. Zuvor will man es bei der Landtagswahl im Februar in Schleswig-Holstein und dann, im Mai, in Nordrhein-Westfalen schaffen. Dort hat die NPD ihren Bundesvorsitzenden als Spitzenkandidaten aufgestellt. Was von diesen Leuten zu erwarten ist, erlebten viele kürzlich im sächsischen Landtag, in dem die NPD „mächtige Schneisen in das Dickicht antideutscher Geschichtslügen“ schlagen will.
Offensichtlich ist aufgrund all dieser Vorgänge und neonazistischen Provokationen eine neue Diskussion über ein Verbot neonazistische Organisationen und Parteien entbrannt. Ob ein neuer Gang nach Karlsruhe erfolgen wird, ist nach der selbstverschuldeten Niederlage mit dem ersten NPD-Verbotsantrag heftig umstritten. Die Auseinandersetzung müsse politisch geführt werden, Grundrechte beim Versammlungsrecht einschränken. Für den Résistance-Kämpfer und Kommunisten Peter Gingold wird die Gefahr der neofaschistischen Massenbasis klein geredet. Gingold kritisierte das Demokratieverständnis führender Politiker, die Nazi-Aufmärsche genehmigten. Nazis dürften nach dem Leid der Konzentrationslager und dem Völkermord nie wieder das Recht haben aufzumarschieren.
Für Bettina Jürgensen vom „Runden Tisch“ in Kiel geht es nun mit der Initiative „Keine Stimme den Nazis“ weiter. Sie will ein Verbot und die Auflösung faschistischer Parteien!
http://www.dkp-online.de/uz/3705/s0102.htm
14. Januar 2005
Nazi-Provokationen in Hamburg-Wilstorf
Zu heftigen Auseinandersetzungen zwischen 100 Neonazis und 300 antifaschistischen Gegendemonstranten ist es am vergangenen Sonnabend im Hamburger Bezirk Harburg gekommen. „Freie Nationalisten“ unter dem Hamburger Neonazi-Chef Christian Worch hatten kurzfristig zu einer Mahnwache für einen „niedergestochenen Kameraden“ und „gegen Ausländergewalt“ aufgerufen. Tatsächlich war es in der Nacht zum 27. Dezember im Harburger Stadtteil Wilstorf zu einer Auseinandersetzung zwischen Skinheads und Jugendlichen gekommen, bei der gegen 2 Uhr in der Frühe sechs Skinheads die Tür eines Wohnhauses einschlugen und mit dem Ruf „Ausländer raus“ mehrere Bewohner bedrohten. Aus Angst wehrte sich einer der angegriffenen Jugendlichen mit einem Messer, wobei einer der Skinheads leicht verletzt wurde.
Solche Vorfälle sind im Stadtteil Wilstorf kein Zufall. Schon seit Jahren ist der Stadtteil eng mit dem Wirken von Nazi-Gruppen verbunden: als Rekrutierungsmittelpunkt der Naziszene südlich der Elbe wie auch als Tatort für ausländerfeindliche Übergriffe. Der ursprünglich eher kleinbürgerlich strukturierte Stadtteil hat durch Arbeitslosigkeit stark gelitten. Soziale Widersprüche sind besonders sichtbar. Zur Normalität des Viertels gehören das Schützenfest und Deutschtümelei, wie andererseits zunehmende Armut. Diese Problemlage hat gerade jüngst neuen Stoff erhalten: Das Harburger Traditionsunternehmen Phönix wird nach der Übernahme durch Continental 1000 Mitarbeiter entlassen. Viele von ihnen wohnen in Wilstorf. Ein idealer Nährboden für neonazistische Rekrutierungsversuche. Auch bundesweit bekannte Kader, wie die Nazianwältin Gisa Pahl, haben sich hier angesiedelt und im benachbarten Sinnstorf produziert die Naziskinband „Oi Drumz“ ihre CDs.
Gegen den Naziaufmarsch hatte ein antifaschistisches Bündnis aufgerufen. Man könne sich im Kampf gegen faschistische Umtriebe nicht auf den Staat verlassen, erklärte der Harburger Antifaschist Jan Malten. Nicht hingenommen werden könne, wenn Neonazis sich nun als Opfer darstellen. Ziel der Antifaschisten war es den Nazi-Aufmarsch zu verhindern. Das verhinderten wiederum mehrere Hundertschaften Bereitschaftspolizei, die den Stadtteil weiträumig abriegelten. Immerhin gelang es den Antifaschisten mit lautstarkem Protest den Nazi-Aufmarsch zu stören.
Für den Hamburger Neonazi-Führer Christian Worch sind solche Aufmärsche gerade jetzt besonders wichtig, ist dieser doch durch seine Kritik an der NPD bei den „Freien Nationalisten“ nicht mehr unumstritten. Worch hatte die zunehmende Dominanz der NPD im rechten Lager beklagt, geriet damit aber – angesichts der Wahlerfolge der NPD – zunehmend in die Isolation. Mit dem Aufmarsch in Harburg wollte Worch Handlungsfähigkeit nachweisen.
Für den 5. Februar haben die „Freien Nationalisten“ von 11 bis 17 Uhr in der Seevepassage in Harburg einen „nationalen Infostand“ angekündigt. Das Antifa-Bündnis ruft erneut zu Protesten auf.
Verwendung: Unsere Zeit
Permalink zu diesem Artikel, Kommentare lesen oder schreiben: hier
Eintrag versenden: hier
Port Package II soll erneut die Hafenwirtschaft in Frage stellen – Protestkundgebungen in deutschen Häfen
Am 20. November 2003 lehnte das Europäische Parlament mit 229 zu 209 Stimmen die Richtlinie zur „Liberalisierung von Hafendienstleistungen“ (Port Package) ab. Erstmalig hatten sich gewerkschaftliche Positionen im EU-Parlament durchgesetzt. Das war eine Sensation. Ein Jahr später sehen sich die Hafenarbeiter erneut herausgefordert. In sieben Ländern und in Rostock, Wismar, Lübeck, Kiel, Brake, Bremen, Bremerhaven, Emden, Nordenham und in Hamburg legten Arbeiter der ersten Schicht am Freitag für dreißig Minuten die Arbeit nieder. Sie informierten sich zum neuen Richtlinien-Entwurf (Port Package II), den die scheidende EU-Verkehrskommissarin Loyola de Palacio am 13. Oktober einbrachte. Die Parlamentsentscheidung aus dem Vorjahr hält sie für nicht akzeptabel.
Mit Port Package steht die ganze Hafenwirtschaft in Frage: Dienstleistungen sollen ausgeschrieben, Schiffsabfertigungen durch Seeleute oder Billig-Jobber erledigt und auf Lotsendienste soll verzichtet werden. Jan Kahmann vom ver.di-Bundesvorstand befürchtet Qualitätsverlust und Sicherheitsmängel beim Warenumschlag. 10 000 Arbeitsplätze wären allein in den Kernbelegschaften gefährdet, 4 000 in Hamburg. Zudem gehe die Tarifbindung verloren. Gute soziale Bedingungen, modernste Technik und hohe Qualitätsstandards prägen die Häfen. Mit Port Package wäre das vorbei. Die Ausschreibung von Hafendienstleistungen für maximal 12 Jahre führe zum Verlust sozialer und technischer Standards, sagt Kahmann. Transnationale Konzerne würden dann Umschlag und Logistik konzentrieren. Tausende weitere Arbeitsplätze wären verloren.
Für den Hamburger Eurogate-Betriebsrat Wilkens waren die Aktionen am Freitag ein Zeichen in Richtung Brüssel: Wer Hafenarbeiter abschreibt, müsse mit Widerstand rechnen. Auch Armin Blechschmidt, VK-Leitung HHLA Burchardkai, TCT-Betriebsrat Harro Jakobs und Thomas Mendrzik, BR-Vorsitzender bei HHLA CT Altenwerder, sind sich einig: Das muss verhindert werden. Mendrzik fügt nachdenklich hinzu: mit der neuen „Bolkestein-Richtlinie“ zur Liberalisierung des europäischen Binnenmarktes sei jetzt ein weiteres Problem vorhanden. Dereguliert wird nun alles, was nicht explizit geregelt ist. Wie die neue Strategie der Europäischen Transportarbeitergewerkschaft (EFT) dagegen aussehen wird, wurde am Montag dieser Woche in der Leitung der Europäischen Transportarbeiterföderation beraten.
Lobbyarbeit allein reiche nicht, sagte Bernt Kamin vor 1 1/2 Jahren der UZ. Außerparlamentarischer Kampf müsse dazu. In der Tat: Erst in dieser Kombination konnte Port Package I verhindert werden. Für den Kommunisten Kamin, Betriebsratsvorsitzender im Gesamthafenbetrieb Hamburg, war es wichtig diese Aktionen mit verschiedenen Ländern zu koordinieren. So gelang das, was bisher selten eingelöst wurde: Grenzüberschreitende politische Arbeitskämpfe. Bevor es nun um neue Strategien gehe, sagt Kamin, müssen deshalb diese Erfahrungen ausgewertet werden.
Die meisten Transportarbeitgewerkschaften in Europa sind Mitglied der Internationalen Transportarbeiter Förderation (ITF) und ihrer europäischen Dependance ETF. Trotzdem blieb es häufig beim Informationsaustausch. Zu unterschiedlich sind die rechtlichen Bedingungen (z. B. Streikrecht), das Verhältnis zum Establishment, Agreements mit Regierungen. Zudem existiert neben dem ITF dasIinternationale Dockworkers Council (IDC), dem die französische CGT und die spanische Coordinadora angehören. Zu den sprachlichen kamen strukturelle Blockaden.
In Deutschland gibt es nur noch 16 000 Hafenarbeiter. Aber diese arbeiten an einem Kernpunkt volkswirtschaftlicher Transportketten. Ein Flaschenhals: Zugedreht, ist der Zu- oder Abfluss von Gütern gestoppt, und die Hafenarbeiter sind gut organisiert. Als im Mai 2003 an der Westküste der USA Arbeitskämpfe stattfanden, bezifferte die Bush-Regierung den Schaden auf 2 Milliarden Dollar am Tag. Just-in-time-Produktion verträgt Transportunterbrechungen nicht.
Um diese Stärke auf Europa zu übertragen war die Verständigung auf ein Kernthema notwendig. Das war die Selbstabfertigung der Schiffe durch Seeleute oder Billigpersonal. Die Hafenarbeiter forderten: Hafenarbeit für Hafenarbeiter, wie es die ILO-Norm 137 vorsieht. Vier strategische Elemente waren das Ergebnis der Verständigung. Das Werben im Parlament für die Rücknahme der Richtlinie. Lobbyarbeit für Korrekturen zur Sicherung sozialer, ökologischer und sicherheitstechnischer Mindeststandards. Kann Letzteres nicht erreicht werden, müssten Restriktionen in die Richtlinie rein, sodass sich diese wieder aufhebt. Koordinierte außerparlamentarische Aktionen, Demonstrationen und Arbeitsniederlegungen. Die Botschaft war klar: Wir werden nicht zulassen, dass Hafenarbeit durch Billig-Jobber oder Seeleute verrichtet wird. Wir sind gut organisiert, durchsetzungsfähig und kampfwillig. Schiffseigner sollten damit rechnen, dass ihre Schiffe notfalls boykottiert werden: in Europa und weltweit. Bei gegebenem Anlass sollten Aktionen zeitgleich in allen Ländern der EU stattfinden. Die CGT konnte über „Nord-Range-Konferenzen“ der belgischen BTB einbezogen werden. Auch das war eine klare Botschaft: die Hafenarbeiter sind koordiniert.
Um das zu erreichen mussten Unterschiede beachtet werden: Was im vereinigten Königreich die Pausenaktion war, war in Malta eine mehrstündige Demonstration, in Deutschland das „Recht auf Demonstration“ (vier Stunden pro Schicht), war in Holland, Frankreich und Belgien ein 24-stündiger Streik. Politisch begründete Arbeitsniederlegungen konnten so in 14 Ländern gleichzeitig stattfinden. Jede Organisation sollte im Rahmen ihrer Möglichkeiten mitmachen und das wurde respektiert. Bernt Kamin zeichnet dafür das Bild einer Familie: da gibt es Stärkere und Schwächere, Kleine und Große, Mutige und nicht so Mutige. Aber eine Familie hält im entscheidenden Moment zusammen. Dann ist alles gleich wichtig.
Die Strategie des Widerstandes entstand im Prozess. Alles wurde mit der Basis rückgekoppelt. 20 000 Hafenarbeiter kamen so aus allen Teilen Europas am 29. September 2003 nach Rotterdam und Barcelona. Das war der Tag, an dem der EU-Vermittlungsausschuss Positionen festlegte. Zuvor hatte es 200 Anträge von EU-Parlamentariern gegeben. Heute sagen die Hafenarbeiter: Wir haben gelernt, wie man gewinnen kann, und es war gar nicht so schwierig.
http://www.dkp-online.de/uz/3648/s0403.htm
Krisenstimmung im Hamburger Rathaus: Das neue Auslieferungszentrum für den Airbus 380 ist in Gefahr
Einen festen Zeitplan hatte Hamburgs Senat für die von Airbus geforderte Verlängerung der Landebahn im Flugzeugwerk Finkenwerder mit dem Konzern bereits beschlossen: um 589 Meter sollte die 2,68 Kilometer lange Landebahn erweitert werden. Doch am 9. August entschied das Hamburger Oberverwaltungsgericht, dass die dafür notwendige Enteignung von 15 Grundeigentümern unrechtmäßig sei. Airbus – samt dem neuen Auslieferungszentrum A 380 – käme auch ohne eine Landebahnverlängerung aus. Nur die Frachtflugzeuge des neuen A 380 könnten hier nicht landen, für diese wenigen Flugzeuge sei aber der Lufthansa-Airport eine durchaus denkbare Alternative.
Airbus-Konzernchef Noel Forgeard knüpft seine Zustimmung für ein Auslieferungszentrum in Hamburg dennoch weiter an die Landebahnverlängerung. Bestünde diesbezüglich bis Ende Oktober keine Planungssicherheit, so sagte er es dem nach Toulouse geeiltem Hamburger Bürgermeister Ole von Beust (CDU), entscheide sich Airbus neu.
170 Hektar Natur sind schon zugeschüttet
Für dieses Auslieferungszentrum hat Hamburg 170 Hektar des Mühlenberger Lochs – ein großes Naturschutzgebiet – zugeschüttet. 750 Millionen Euro kostete das die Stadt. Nichts war dem Senat zu teuer um den A 380 nach Hamburg zu holen. Bis vor drei Jahren schien selbst die Endmontage des A 380 eine Option für Hamburg. 10 000 Arbeitsplätze sollten so entstehen. Doch diese Endmontage, das stand schnell fest, geht nach Toulouse. Wirtschaftssenator Gunnar Ulldal (CDU) musste deshalb seine Schätzungen immer wieder korrigieren. Zum Schluss ist er bei 2 000 neuen Arbeitsplätzen gelandet. Filmregisseur Hark Bohm – einer der prominentesten Kritiker des Projekts – bezweifelt selbst dies. Neue Arbeitsplätze – so Bohm – entstünden vor allem bei kleineren Modellreihen, während das Auslieferungszentrum selbst „maximal“ 100 bis 150 brächte.
Airbus-Werk bekam Status der Gemeinnützigkeit
Die Landebahnverlängerung wurde erst öffentlich, als das Mühlenberger Loch bereits zugeschüttet war. Weitere 56 Millionen Euro kostet das nun. Zur Befriedung auch dieses Wunsches beschloss eine große Allparteienkoalition noch vor den Wahlen dem Airbus-Werk per Gesetz den Status der Gemeinnützigkeit zu verleihen. Eine Enteignung der Grundeigentümer schien so besser möglich. 236 Anrainer bildeten darauf hin die Klagegemeinschaft „Schutzbündnis für die Elbregion“. An der Spitze steht die Obstbäuerin Gabi Quast, deren Familie hier schon in der elften Generation ansässig ist.
Dem Bündnis geht es um ein großes Obstanbaugebiet und um das 943 Jahre alte Dorf Neuenfelde. Nun aber sollen rote Backsteinhäuser und Apfelbaumplantagen weichen. Immer wieder verwiesen die Anrainer darauf, dass die Landebahnerweiterung gar nicht nötig sei. Ihre Heimat für vage Zukunftsplanungen zu opfern, kam für sie nicht in Frage.
Eigner wollen sich nicht kaufen lassen
So war es kein Wunder, dass der Senat auch bei weiteren Initiativen auf Widerstand stieß. Nach verlorener Gerichtsschlacht dachten sich die Hamburger Politiker das, was sie immer denken: alles ist eine Frage des Preises. So verdreifachte der Senat sein Kaufangebot für die begehrten Grundstücke auf satte 61,50 Euro pro Quadratmeter. Gleichzeitig aber setzte er die Bedingung, dass die nun bis 1. Oktober verkauft haben. Doch sieben dieser Eigner sind Teil des Schutzbündnisses. Sie hielten an ihrer Entscheidung fest: „Wir bleiben, wo wir sind.“
Ole von Beust: „Es geht um nationale Interessen“
Seitdem herrscht hektische Betriebsamkeit im Rathaus. Am 12. Oktober trat Ole von Beust schließlich vor die Landespressekonferenz. 100 Journalisten drängten sich im Raum 151 des Rathauses. So voll war es seit der Entlassung von Schill nicht mehr. Beust zog alle Register: Es gehe um „nationale Interessen“, denn nur noch in wenigen Bereichen könnten wir „weltweit mithalten“. Dazu zähle die Luftfahrtindustrie. Hier gehe es nicht um einen Kampf „David gegen Goliath“, sondern um die Wettbewerbsfähigkeit Deutschlands in der ganzen Welt.
Ganz der Stadtvater, gab es aber auch warme Worte des Verständnisses: Legitim und nachvollziehbar sei der Widerstand gewesen. Nun aber müsse Schluss sein, denn die „Glaubwürdigkeit des Landes als internationaler Industriestandort“ sei sonst erschüttert.
Definitiv sei dies die letzte Werkserweiterung, so der Bürgermeister, der nun selbst eine Bestandsgarantie für das Dorf abgeben wollte. Gute Nachbarschaft will auch Airbus-Deutschland-Chef Gerhard Puttfarcken. Drei Millionen Euro spendet er dem Dorf, vorausgesetzt die Grundstücke werden endlich verkauft. Zuschüsse für die freiwillige Feuerwehr und den Sportverein seien möglich. Was, so fragt Gabi Quast, sei aber eine Bestandsgarantie wert, wenn Airbus selbst diese nicht gebe? Und auch die Spende des Konzerns konnte das Dorf nicht wirklich erfreuen. John-Henry Köster vom Vorstand der Kirchengemeinde bringt es auf den Punkt: „Was soll eine Gemeinde mit Geld, wenn sie keine Gemeinde mehr hat.“
Mit EADS auf Augenhöhe zu US-Amerikanern
Ändert sich an der Haltung der Eigner bis Ende Oktober nichts, könnte der Stadt eine große Subventionspleite drohen. Auf der anderen Seite bildet aber die Luftfahrtindustrie nicht zufällig ein Prioritätsprojekt Deutsch-Französischer Zusammenarbeit. Hier besteht eine enge Symbiose zur Rüstungsindustrie.
Airbus gehört zu zwei Dritteln der „European Aeronatic Defence and Space Company“ (EADS), die den Kern eines neuen militärisch-industriellen Komplexes darstellt. Über die Vereinigung der deutschen DASA (Daimler Crysler und die Deutsche Bank) mit dem französischen Rüstungskonzern „Aerospatiale Matra“ ist ein Konzern entstanden, der insbesondere von staatlichen Subventionen wie Rüstungsaufträgen lebt, ja dafür geschaffen wurde. „Mit EADS sind die Europäer endlich auf Augenhöhe mit den Amerikanern“ schwärmte der damalige Co-Chef von EADS Rainer Hertrich schon bei der Gründung des europäischen Riesen. Kürzlich konnten sogar Nautikaufträge aus dem Pentagon übernommen werden.
Träumt Ole von Beust schon vom Airbus 400 M?
Zum Produktionsprogramm der Airbus gehört auch das neue Militärtransportflugzeug A 400 M. Ist es nicht denkbar, dass Hamburgs Bürgermeister Ole von Beust, nach verlorener Schlacht mit den Bauern – und mit bekannt unschuldiger Miene – dann von Verhandlungen mit Konzernchef Forgeard zurückkommt, um die Übernahme der Produktion des A 400 M oder bestimmter Komponenten daran zu feiern? Im benachbarten Bremen wird darüber schon spekuliert. Jedenfalls ist es schwer vorstellbar, dass 750 Millionen Euro staatlicher Subventionen und 600 Millionen Euro betrieblicher Investitionen einfach so in den Sand gesetzt werden.
http://www.dkp-online.de/uz/3643/s0604.htm
Vom Kampf des Hamburger „Kita-Bündnisses“
Fünfzig Millionen Euro sollen Hamburgs Kindertagesstätten ab 1. Januar 2005 „einsparen“. Gleichzeitig will der Senat aber die Anzahl der Kita-Plätze um 5 000 erhöhen. Mit weniger Geld mehr Plätze? Entlassungen, Gehaltskürzungen und schlechtere Arbeitsbedingungen befürchten die 9 500 Mitarbeiter. Eltern, Erziehungswissenschaftler und die GEW warnen vor einem Qualitätsverlust in der frühkindlichen Bildung. Sie sagen: Insbesondere Kinder aus sozial schwachen Familien fallen schon jetzt durchs Raster. Der Unmut ist groß. In Betriebsversammlungen, Aktionen und Demonstrationen formiert sich Widerstand. 8 000 Mitarbeiter, Eltern und Kinder zogen Anfang September mit Losungen wie „Macht ihr erst die Kita platt, wächst nichts mehr in dieser Stadt“ vor das Rathaus. Doch die Verhandlungen zwischen den Trägern und der Sozialbehörde blieben ohne Ergebnis. Das Hamburger „Kita-Bündnis“ – in dem sich Betriebsräte und Vertreter vieler Träger zusammenschlossen – weitet nun seine Proteste aus.
Darum geht es: Seit dem 1. August 2003 gilt in Hamburg ein neues Kita-Gutscheinsystem. Eltern erhalten einen Gutschein, auf dem die Leistung und die Anzahl der Betreuungsstunden vermerkt sind. Sie lösen diesen bei einer Einrichtung ihrer Wahl ein. Jeder Gutschein hat einen pauschalisierten Gebäude-, Personal- und Sachkostenwert, auch Entgelt genannt. Bei der Umstellung auf dieses System reagierten Initiativen und die oppositionelle SPD mit einem Volksbegehren. Standards sollten gesichert werden. Nach den Bürgerschaftswahlen schlossen CDU und SPD den „Kita-Kompromiss“. Vordergründig war von einer Ausweitung der „Rechtsansprüche für Kinder von Berufstätigen“ sowie des „Betreuungsanspruches für die Drei- bis Sechsjährigen von vier auf fünf Stunden“ die Rede. Da aber auch letzteres mit erhöhten Eigenleistungen der Eltern kombiniert ist, ergibt sich tatsächlich eine Abkehr von der Prioritätensetzung für sozial benachteiligte Kinder. Unklar blieb zudem, wie die Mehrkosten für die Ausweitung der Kita-Plätze zu finanzieren sind. Mitte des Jahres sprach Sozialsenatorin Birgit Schnieber-Jastram (CDU) Klartext: Ihr gehe es nicht um Mehrkosten, sondern um eine Kürzung der Kita-Mittel. Nominell veranschlagte sie eine 50 Millionen-Haushaltskürzung, die sich aber schnell auf satte 80 Millionen hochrechnet, werden Mehrausgaben bei den Trägern aus der größeren Anzahl von Kita-Plätzen einberechnet.
Erreicht werden soll das „Sparziel“ vor allem durch eine Absenkung der Personalkosten. 49 Millionen sollen durch Stellenstreichungen und abgesenkte Löhne eingefahren werden. Bei der städtischen „Vereinigung Hamburger Kindertagesstätten“ – hier sind rund die Hälfte der Kita-Plätze konzentriert – fürchtet der Betriebsrat deshalb um jede vierte Stelle. Erhebliche Kürzungen sind auch bei den Sachmitteln und den Gebäudekosten avisiert. Durch pauschalisierte Sätze werden zudem die kleineren Träger benachteiligt. Sie errechnen nun (völlig irreale) Gruppengrößen im Hortbereich von bis zu 31 Kindern, was viele tatsächlich in die Pleite führen würde.
Michael Edele, Verhandlungsführer der „Arbeitsgemeinschaft der freien Wohlfahrtsverbände“ stellte hierzu fest: „Das Verhandlungsangebot der Behörde ist nicht akzeptabel. In Verantwortung für die von uns betreuten Kinder können wir den Forderungen nicht entsprechen.“ Doch für den Fall, dass die Verhandlungen scheitern, will die Senatorin gerüstet sein. Mit Hilfe eines „Einführungsgesetzes“ sollen neue Kostensätze den Trägern dann per Rechtsverordnung einfach diktiert werden. Am 27. Oktober steht das Gesetz in zweiter Lesung zur Beschlussfassung auf der Tagesordnung der Bürgerschaft. Um sich abzusichern gab die Sozialbehörde ein Rechtsgutachten in Auftrag. Doch nun wird dessen Veröffentlichung verweigert, sickerte doch durch, dass die bestellten Gutachter das Gesetz für rechtswidrig halten. Es sei nicht zulässig, bestimmte Ausstattungsstandards hinsichtlich Personal und Flächen einfach vorzugeben, wenn zugleich die Finanzierung den Bedarf nicht decke, so die trockene Bilanz namhafter Juristen.
Gleichzeitig lassen die Proteste der Erzieher und Eltern nicht nach. Nach einer Betriebsversammlung bei der „Vereinigung“ gingen erneut tausend Menschen auf die Straße. Sie wehrten sich gegen die Pläne ihres eigenen Geschäftsführers Dr. Martin Schaedel, der – dem Senat zum Wohlgefallen – bereits Kürzungen im hauswirtschaftlichen Bereich ankündigte und Tarifstrukturen in Zweifel zog. Hamburgs ver.di-Chef Wolfgang Rose vertritt hier eine klare Linie: „Wir werden nicht zum Vorreiter einer Dumpingspirale nach unten, auf die dann andere aufspringen und noch weitergehende Absenkungsforderungen stellen“, stellte Rose klar.
Kämpferisch gibt sich auch das Hamburger „Kita-Bündnis“, in dem sich die Betriebsräte der großen Träger, Vertreter kleinerer Träger und Elterverbände vereinigt haben. Das Bündnis fordert die Vielfalt der Einrichtungen und damit verbundene Wahlmöglichkeiten für Eltern zu erhalten. Zudem sei jede Kürzung ein weiterer Schritt in Richtung sozialer Ausgrenzung, denn soziale Prioritäten bei der Aufnahme würden immer weiter zurückgedrängt. Um gut zu arbeiten, dürfe der Haushalt nicht gekürzt, sondern müsse erweitert werden. Vehement wendet sich das Bündnis gegen die Kürzungen beim Weihnachts- und Urlaubsgeld und die vorgesehene Fremdvergabe des hauswirtschaftlichen Bereichs. Entlassungen will das Bündnis nicht hinnehmen. Sprecher Ronni Prieß erklärte gegenüber der UZ, dass nur mit verstärktem Protest ein Kurswechsel erreicht werden könne. Wörtlich: „Wenn am 22. Oktober um 17 Uhr im Rathaus die Expertenanhörung zum Thema stattfindet, dann sollte der Saal sehr voll sein. Und wenn wir am 26. Oktober erneut demonstrieren, dann sollten sich Tausende Hamburger diesem Protest anschließen.“
http://www.dkp-online.de/uz/3642/s0602.htm
Im September 2001 wird in Hamburg gewählt. Doch der Wahlkampf hat bereits begonnen: Am rechten Rand gründete der als „Richter Gnadenlos“ bekanntgewordene Hamburger Richter Ronald Barnabas Schill am 13. Juli eine neue Partei.
Bis zu 30 Prozent will er erreichen. Führende CDU-Politiker in der Hansestadt reagieren nervös. So fordert der einflussreiche Harburger Kreisvorsitzende Andreas Kühn inzwischen offen, dass die CDU das „Asyl“ und das „Kriminalitätsthema“ mit „deutlicheren Konturen“ besetzen müsse. Ein verschärfter „Law-and-order“-Wahlkampf kündigt sich an. Doch auch die Linke macht mobil. Der am 15. Juli neu gewählte PDS-Landesvorstand will ein „öffentliches Plenum der linken Kräfte“, um sich dort „über ein gemeinsames Vorgehen zu verständigen“.
Unter Ausschluss der Öffentlichkeit wurde die neue Rechtspartei gegründet. Doch ihr Name ist Programm: „PRO“, die „Partei der Rechtsstaatlichen Offensive“. Das klingt irgendwie aufgeräumt. „Aufräumen“ wollen sie in der Tat und sie haben ein Hauptthema: Innere Sicherheit. Sie fordern „Konsequentes Handeln gegen Kriminelle“, und meinen damit arbeitslose und gestrauchelte Jugendliche. Ihre Lösungen: Heimunterbringung mit „unwirtlichen Einzelzellen“.
Sind es Menschen ohne deutschen Pass, dann soll abgeschoben werden, „sofort und auf der Stelle“. „In 100 Tagen“ werde seine Formation „die Verbrechen halbieren“, sagt Schill. Und bei der mächtigen Springer-Presse findet das Unterstützung. Das „Hamburger Abendblatt“ ermittelt ein Wählerpotenzial von bis zu 30 Prozent. Schill bedankt sich und sagt, er wolle insbesondere Wähler erreichen, „die von der SPD verraten und verkauft“ wurden.
Schill will nicht nur das rechtsextremistische Spektrum erreichen (immerhin verfehlte die DVU bei den letzten Bürgerschaftswahlen den Parlamentseinzug nur knapp), sondern auch „ehrbare“ Kaufleute, Angestellte und Juristen überzeugen; will Akzeptanz auch in bürgerlichen Kreisen. Das Presseecho ist enorm. Im Hamburg-Teil der „Welt“ kann sich Schill seitenlang erklären. Das Blatt berichtet über Schill mehr als über alle anderen Parteien. Die Arbeitslosen oder niedrig verdienenden Menschen in Hamm, Horn, auf der Veddel und in Wilhelmsburg können sich im örtlichen „Lokalboten“ bedienen. Seitenweise wird in dem Anzeigenblatt für Schill, für „Recht und Ordnung“ geworben. Ganze Ortsverbände der CDU haben Schill zu Vorträgen geladen: Lurup/Osdorfer Born, Niendorf, aber auch Wandsbek. Und Andreas Kuhn, Kreisvorsitzender der Harburger CDU, träumt bereits von einer Koalition mit PRO.
Hamburgs Haider
Hat Hamburg einen neuen Haider? Hoffentlich nicht! Aber der Richter will nun auch in der Politik das praktizieren, was er im Amt längst tat und was ihm selbst ein Strafverfahren einbrachte: Rechtsbeugung gegenüber Andersdenkenden. In seinem letzten spektakulären Prozess verurteilte Schill einen Mann aus dem autonomen Lager wegen „Widerstands gegen die Staatsgewalt“ ruckzuck zu 14 Monaten Haft – ohne Bewährung, versteht sich. Der Tatbestand: wildes Plakatieren (nicht irgendwo, sondern in der Hafenstraße!). Schill will das Strafmündigkeitsalter auf zwölf Jahre senken. Er fordert die Wiedereinführung der Todesstrafe. Offen sagt er, Ausländer sind „viel krimineller als Deutsche“. „Rechtsfreie Räume“, gemeint sind Kulturzentren, sollen „geräumt“ werden. Dann Schluss mit „sozialer Selbstbedienungsmentalität“ und die Atomenergie soll energisch ausgebaut werden!
Schill knüpft nicht nur an latent vorhandene ausländerfeindliche Stimmungen an, sondern er nutzt geschickt die Enttäuschung vieler Menschen über den rot-grünen Senat, der Hamburg seit 1997 regiert. Seine plumpen Parolen finden leider auch in größeren Teilen der Arbeiterschaft, der Jugend und bei älteren Menschen Gehör.
Kein Thema ist dem Richter zu schade, um es nicht demagogisch zu nutzen. Kaum hat man geschluckt bei der Forderung „Entfernung von Bettlern und Junkies“ aus dem öffentlichen Raum, kommt die nächste Keule: Front will er machen, gegen eine Schulreform, die „mittels Gleichheitsutopie, Lustprinzip und Machbarkeitswahn herkömmliche, funktionstüchtige Schule weitgehend demontiert, um via Schule zu einem Umbau der Gesellschaft ist Sinne linker Theorie zu gelangen“.
Linkes Bündnis
Henning Voscherau, bis 1997 Bürgermeister, selbst ein sich getreuer „Law-and-order“-Mann, warnt seine Partei scheinheilig davor, Schill könne „Zünglein an der Waage sein, (vielleicht sogar) einen Bundesverband (gründen), als deutsche Schwesterpartei für den Landeshauptmann aus Kärnten“. Damit dies nicht geschehe, fordert Voscherau für die SPD ein Ende der „Halbherzigkeiten“ und beschwört „Political Correctness“. Sein Rezept: ´Endlich über den eigenen Schatten springen und wirksam vorbeugen, als später die Hände in Unschuldwaschen zu müssen. „Law and order“ auf allen Seiten und in neuer Qualität. Hamburg steht ein heißer Wahlkampf bevor, der in manchem tatsächlich an österreichische Verhältnisse erinnert.
Die Linke diskutiert, wie kürzlich in der UZ berichtet, schon seit längerem, wie dem zu begegnen ist. Zudem: Gemeinsam könnte auch die Linke ins Parlament einziehen, damit ein wirksames Gegengewicht bilden. Aber eben nur gemeinsam. Jetzt war die PDS am Zug. Sie wählte auf einer gut besuchten Landesversammlung einen neuen Vorstand, denn der alte (ebenfalls linke) war, so der innerparteilich erhobene Vorwurf, zu offener Bündnispolitik (intern wie extern) nicht mehr bereit. In verschiedensten Medien wird über diesen Kurswechsel in der Hamburgischer PDS lebhaft spekuliert, wobei es mir manchmal an örtlicher Verbundenheit oder an gesicherten Kenntnissen mangelt. Bleiben wir für diese Zeitung daher bei überprüfbaren Fakten, ohne uns damit in innere Angelegenheiten der PDS einzumischen:
Der Kurswechsel wurde ausgelöst von der „Gruppe Linker Dialog“, die mit Blick auf zukünftige Wahlpolitik erklärte: „Wir wollen ein breites Bündnis linker Kräfte von Regenbogen, Sozialpolitischer Opposition, DKP, Gewerkschafter, PDS u. a.“
Auf der PDS-Landesversammlung erhielt der mit großer Unterstützung der Hamburger PDS-Mitglieder und sympathisierenden gewählte neue Landesvorstand dann am 15. Juli den Auftrag, „Gespräche zu führen mit potenziellen Bündnispartnern und dabei für unser Konzept einer wahlpolitischen Orientierung zu werben“. Dies Konzept wird erläutert: „Wir streben ein öffentliches Plenum der linken Kräfte in Hamburg an, auf dem eine breite Verständigung über ein gemeinsames Agieren hergestellt werden soll.“
Der neue PDS-Landesgeschäftsführer Roman Scharwächter hat dies inzwischen präzisiert: „Dabei geht es nicht nur um die Bürgerschaftswahlen als solche, sondern um die Möglichkeit, ein Bündnis unterschiedlicher fortschrittlicher Kräfte zu organisieren, das die weltanschaulichen und organisationspolitischen Differenzen respektiert und aus der Diskussion die Kraft zu gemeinsamen politischen Handeln gewinnt. Insbesondere vor dem Hintergrund der Formierung reaktionärer bis rechtspopulistischer Kräfte in der gerade erfolgenden Grundung-der ´Schill-and-order-Partei´ und des angekündigten Rechtsaußenwahlkampfs der CDU wird die Notwendigkeit eines gemeinsamen Vorgehens der politischen Linken offenbar.“
http://www.dkp-online.de/wahlen/land/hamb01/32320403.htm
Gelingt es der Hamburger Linken im September 2001 in die Bürgerschaft einzuziehen?
Bereits am 30. Mai beschloss der Verein „Regenbogen – Für eine neue Linke“ einstimmig seine Wahlbeteiligung bei den nächsten Bürgerschaftswahlen. Regenbogen – entstanden in antimilitaristischer Abgrenzung zum oliv-grünen Kriegskurs von Bündnis 90/Die Grünen – ist schon jetzt mit einer Gruppe von fünf Abgeordneten im Hamburger Landesparlament vertreten. Darüber hinaus mit zahlreichen Fraktionen in den Bezirksparlamenten.
Am 15. Juli will nun die PDS auf einer Landesversammlung im traditionsreichen Haus für Alle (Amandastraße 58 ab 10 Uhr) nicht nur wahlpolitische Positionen beschließen, sondern auch einen neuen Landesvorstand wählen. Zusammen kommen PDS und Regenbogen – nach jüngsten Meinungsumfragen – gegenwärtig auf etwa 4,5 Prozent der Wählerstimmen!
Die Lage ist günstig
Die Situation ist so günstig wie lange nicht mehr. Erstmalig seit vielen Jahren könnte die Hamburger Linke einen Wahlkampf wieder mit parlamentarischer Präsenz und parlamentarischem Ergebnis führen! Die Sprecherin von Regenbogen, Heike Sudmann, erklärte uns hierzu: „Unser Ziel ist es, auch in Zukunft die politische Debatte in der Stadt mitzubestimmen und Kontrapunkte zur herrschenden Meinung zu setzen.“ Damit dies gelingen kann, will „Regenbogen – für eine neue Linke“ den Wahlkampf als „offenes Projekt führen, zusammen mit allen Interessierten, mit unterschiedlichen Einzelpersonen und Zusammenhängen.“ Eine Wahlplattform soll im Herbst entstehen, dann sollen die genaueren Modifikationen des Eingreifens festgelegt werden.
Es ist in der Stadt ein offenes Geheimnis: Ohne eine Allianz der Linksalternativen und -grünen mit den sozialistischen Gruppen in der Stadt ist dieses ehrgeizige Ziel, erneut ins Landesparlament einzuziehen, freilich nicht zu erreichen. Bereits im Mai bekundete „Regenbogen – für eine neue Linke“ deshalb seine Bereitschaft zu offenen Listen. Inzwischen ist diese Debatte fortgeschritten.
Etlichen Mitgliedern – unter ihnen auch Abgeordneten in der Bürgerschaft – ist vollständig klar, dass ein wahlpolitischer Erfolg nicht nur nicht in Konkurrenz zum sozialistischen Spektrum möglich ist, sondern dass es hierfür notwendig ist, gemeinsames Eingreifen den Bürgerinnen und Bürger auch über den Titel der Liste selbst kenntlich zu machen. Das wäre deutlich weniger als ein Parteienbündnis, viel mehr aber als ein reine Liste von Regenbogen mit ein paar Plätzen für andere. Zusammenarbeit ist auch deshalb notwendig, weil beide Gruppen zu unterschiedliche Bevölkerungsschichten ansprechen.
Die Diskussion bei der PDS geht inzwischen in die gleiche Richtung. In einem Interview mit der Jungen Welt erklärten Roman Scharwächer und Dirk Prösdorf von der PDS-Gruppe „Linker Dialog“: „Wir wollen ein breites Wahlbündnis linker Kräfte – Regenbogen, Sozialpolitische Opposition, DKP, Gewerkschafter, PDS u.a.“ Damit sich dies allerdings realisieren könne, sind – nach Einschätzung nicht nur des „Linken Dialog“, sondern, wie die letzte PDS-Versammlung zeigte, einer Vielzahl von PDS-Mitgliedern – auch bei der PDS Veränderungen notwendig.
Der gegenwärtig den Landesvorstand dominierenden Hochschulgruppe LINKS wird vorgeworfen, sich vehement gegen jegliche realistische Form wahlpolitischer Gemeinsamkeit bei den kommenden Wahlen ausgesprochen zu haben. Viele werfen der Gruppe, der es 1997 – nachdem viele Mitglieder der PDS nach dem Schweriner Parteitag ausgetreten wären oder sich zurückgezogen hatten – gelungen war, in stärkeren Umfang in Vorstandsfunktionen der hanseatischen PDS vorzurücken, zudem ausgrenzendes Verhalten vor. Eingefordert wird politische Wirksamkeit auch „außerhalb der Parteigeschäftsstelle“ zu entwickeln.
Wie bunt ist der Regenbogen?
Wie tief die Meinungsverschiedenheiten auch im linken Spektrum der PDS sind, wird im Antrag der Gruppe „Linker Dialog“, der von verschiedenen Parteigliederungen unterstützt wird, deutlich. Dort heißt es: „Die Versuche Bündnispolitik als Verlängerung des ideologischen Streites (in der PDS) zu führen, sind kontraproduktiv, (genauso) wie instrumentell Bündnispartner durch die völlige Ausklammerung ideologischer und politischer Differenzen mit ihnen zu Verbündeten im innerparteilichen Streit zu machen.“ Die Gruppe unterstreicht gleichzeitig die wahlpolitischen Möglichkeiten für 2001: „Es wäre möglich, gemeinsam über die momentan durch den Regenbogen realisierte parlamentarische Vertretung hinaus – sich das ´Spielbein´ für die Linke in dieser Stadt mit einer dauerhaften Perspektive zurückzuerobern.“ Natürlich will man dafür eigene Themenbereiche einbringen, noch wichtiger sei aber, auch auf das zurückzugreifen, was es in der außerparlamentarischen Bewegung – so zum Beispiel im Hamburger Forum, in der Sozialpolitischen Opposition oder in der Antifa-Bewegung – schon gibt.
Wie man auch immer den Streit der mehrheitlich links stehenden Mitglieder und Sympathisierenden der Hamburger PDS bewerten mag, so bleibt doch festzuhalten, dass die am 17. Juni stattgefundene Landesversammlung der PDS nun mit großer Mehrheit ein Verfahren beschlossen hat, um sich mit diesen Forderungen zu beschäftigen. Die Versammlung beschloss Neuwahlen für den Landesvorstand, die nun am 15. Juli stattfinden sollen und nachdem sich die PDS auf „Eckpunkte zur weiteren Arbeit, zur Landespolitik und zu den Bürgerschaftswahlen“ verständigt hat.
Und was sagt die DKP?
Die DKP hat ihre eigenes wahlpolitischen Eingreifen bei den Bürgerschaftswahlen 2001 noch nicht beschlossen. Viele GenossInnen wollen zunächst den weiteren Klärungsprozess in der Hamburger PDS abwarten. In jedem Fall, so die übereinstimmende Position bei einer kürzlich stattgefundenen Aktivtagung zur Auswertung des Parteitages, will die Partei aber mit eigenen inhaltlichen Positionen eingreifen.
Die Handlungsorientierung unseres jüngsten Parteitages hat erneut darauf verwiesen, dass wir als Kommunistinnen und Kommunisten alles in unseres Kräften Stehende dafür aufbringen sollten, dass gemeinsamer Widerstand aller linken und demokratischen Kräfte im Kampf gegen die gesellschaftliche Rechtsentwicklung möglich wird. In Hamburg fährt die rot-grüne Koalition eine gnadenlose Sparpolitik, mit der selbst Ansprüche aus der Sozialhilfe in Frage gestellt sind. Sozialdemokratische und grüne Senatoren ermöglichen es, dass in unserer Stadt neofaschistische Gruppen aufmarschieren. Bildung wird zunehmend privatisiert. Im Echo dieser Politik formiert sich auch rechts eine neue Wahlformation: Richter „Gnadenlos“ Ronald Schill will mit einer eigenen Partei antreten, denn die hanseatische CDU ist ihm „zu links“. In Umfragen ist diesem Haider-Verschnitt ein Erfolg von bis zu acht Prozent der Stimmen vorausgesagt.
In dieser Situation sind alle Linken in unserer Stadt gefordert, auch im parlamentarischen Eingreifen, das zu realisieren, was wir außerparlamentarisch längst tun: Gemeinsam zu handeln! Die Chancen hierzu stehen so gut wie lange nicht mehr.
http://www.dkp-online.de/wahlen/land/hamb01/32290602.htm
 Gespräch mit Olaf Harms zu den Bürgerschaftswahlen in Hamburg
Gespräch mit Olaf Harms zu den Bürgerschaftswahlen in Hamburg

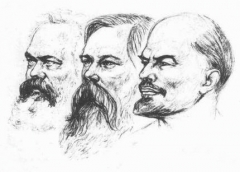
 Streik der Hamburger Hafenarbeiter gegen Privatisierung der HHLA
Streik der Hamburger Hafenarbeiter gegen Privatisierung der HHLA